Die Lugmeier-Biographie wurde nun auch in der Schweizer Wochenzeitschrift "WOZ" (12.10. 2005) gewürdigt, wonach es eben keine normale Gangsterbiographie geworden sei, sondern hier einer die "Lufthoheit" über sein eigenes Leben behalten habe:
"Jetzt ist «Der Mann, der aus dem Fenster sprang» erschienen, Lugmeiers autobiografische Erinnerungen mit dem Untertitel «Ein Leben zwischen Flucht und Angriff». Packend beschreibt er darin die rastlosen Momente seiner Gangsterkarriere, schildert lakonisch die Kindheit im katholisch geprägten Oberbayern, verarbeitet auch das Abdriften ins Milieu zu schlanker Poesie und gibt die bizarren Erlebnisse auf den Bahamas wieder, wo er als irischer Geschäftsmann «John Michael Waller» ins Hotelwesen einsteigen wollte. Anders als bei den üblichen Sensationsbeichten hat hier kein investigativer Journalist die Erlebnisse zu Räuberpistolen aufgefeilt. Der Bayer hat sich in seinem Leben zweifelsohne grobe Schnitzer geleistet. Aber Lugmeier, und das unterscheidet seine von anderen Gangsterbiografien, hat symbolisches Kapital daraus geschlagen, da er die Lufthoheit über die Schilderung seiner Erlebnisse behalten hat. Die eigenen Formulierungen klingen ohnehin viel besser als alles, was je über ihn geschrieben wurde. Wenn schon Mythenbildung, dann wenigstens aus erster Hand. «Der Buchgestaltung gingen natürlich dramaturgische Überlegungen voran, und stilistische Reduktion war notwendig. So ist das Buch fast ein autobiografischer Roman geworden. Ich wollte nicht neben mir stehen und der Ghostwriter der eigenen Geschichte sein.»"
Dabei fällt auf, dass die meisten ausführlichen Rezensionen über das Lugmeier-Buch allesamt die literatische Qualität dieses Textes würdigen.
Falsche Behauptungen über Dimitri Todorov
Die Rezension von Julian Weber enthält aber leider eine grob falsche Behauptung über Dimitri Todorov:
"Die Bekanntschaft mit anderen Häftlingen gibt ihm literarische Impulse. Eigentlich wollte er mit Dimitri Todorov zusammen Dinger drehen. Aber jener kommt ihm zuvor und wird 1971 für die erste, gewaltsam endende Geiselnahme nach einem Bankraub in der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. Anders als Todorov hat Lugmeier niemanden getötet, ist haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt."
Also zunächst einmal hat Todorov niemanden getötet.
Er wurde zum einen für angeblich in Tötungsabsicht abgegebene Schüsse bei der Stürmung der Deutschen Bank verurteilt, wobei allerdings niemand zu schaden kam und Aussage gegen Aussage stand, ob es sich tatsächlich um gezielte Schüsse gehandelt habe.
Zum zweiten wurde er dafür verurteilt, dass sein Tatgenosse Georg Rammelmaier während des Banküberfalls angeblich eine Geisel getötet habe. Die Geisel kam bei einem vom Schreiber'schen Polizeikommando begonnenen Schusswechsel ums Leben. Es wurde dabei aber für Außenstehende nie zufriedenstellend geklärt, ob es nicht etwa die Polizeikugeln waren die die Frau das Leben gekostet hatte (Bad Kleinen lässt grüßen - Die Münchner Polizei zeigte sich Anfang der 70er Jahre in vergleichbaren Situationen mehrfach völlig überfordert. Soviel nur hierzu.
-------------------
Nachträgliche Anmerkung am 20.10. 2005. Nach einem Hinweis an die Redaktion der WOZ meldete sich der Verfasser und räumte den Irrtum ein. U.a. schrieb er in einer E-Mail:
"Dein Einwurf ist richtig, ich lag falsch: Todorov hat niemand umgebracht. Es hätte in dem Text stehen müssen: An Aktionen, bei denen Lugmeiner beteiligt war, sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Das habe ich der Woz auch mitgeteilt."
-------------------
Zur politischen Dimension des Lugmeierschen Lebens
"Die mexikanische Presse bezeichnete Lugmeier seinerzeit als Anführer einer Anarchistengruppe. Seine Biografie überschneidet sich tatsächlich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte auf verblüffende Weise: Im Jahr der Gründung der Bundesrepublik, 1949, Geburt, 1977 (Deutscher Herbst) Festnahme, 1989 Entlassung, kurz vor der Wiedervereinigung. Aber Lugmeier ist nicht in dem Sinne politisch, auch wenn seine Entscheidungen oftmals von Radikalität getragen waren und prominente Linke sich mit ihm verbunden fühlten. «Geld war wichtig für mich. Es hat mir in meiner Entwicklung geholfen. Ich kam so mit anderen Gesellschaftsschichten in Berührung. Aber das war nicht die Verwirklichung meiner Träume. Ich bin durch das Geld nicht unabhängig geworden, sondern in die Rolle des Gejagten geraten.»"
"Jetzt ist «Der Mann, der aus dem Fenster sprang» erschienen, Lugmeiers autobiografische Erinnerungen mit dem Untertitel «Ein Leben zwischen Flucht und Angriff». Packend beschreibt er darin die rastlosen Momente seiner Gangsterkarriere, schildert lakonisch die Kindheit im katholisch geprägten Oberbayern, verarbeitet auch das Abdriften ins Milieu zu schlanker Poesie und gibt die bizarren Erlebnisse auf den Bahamas wieder, wo er als irischer Geschäftsmann «John Michael Waller» ins Hotelwesen einsteigen wollte. Anders als bei den üblichen Sensationsbeichten hat hier kein investigativer Journalist die Erlebnisse zu Räuberpistolen aufgefeilt. Der Bayer hat sich in seinem Leben zweifelsohne grobe Schnitzer geleistet. Aber Lugmeier, und das unterscheidet seine von anderen Gangsterbiografien, hat symbolisches Kapital daraus geschlagen, da er die Lufthoheit über die Schilderung seiner Erlebnisse behalten hat. Die eigenen Formulierungen klingen ohnehin viel besser als alles, was je über ihn geschrieben wurde. Wenn schon Mythenbildung, dann wenigstens aus erster Hand. «Der Buchgestaltung gingen natürlich dramaturgische Überlegungen voran, und stilistische Reduktion war notwendig. So ist das Buch fast ein autobiografischer Roman geworden. Ich wollte nicht neben mir stehen und der Ghostwriter der eigenen Geschichte sein.»"
Dabei fällt auf, dass die meisten ausführlichen Rezensionen über das Lugmeier-Buch allesamt die literatische Qualität dieses Textes würdigen.
Falsche Behauptungen über Dimitri Todorov
Die Rezension von Julian Weber enthält aber leider eine grob falsche Behauptung über Dimitri Todorov:
"Die Bekanntschaft mit anderen Häftlingen gibt ihm literarische Impulse. Eigentlich wollte er mit Dimitri Todorov zusammen Dinger drehen. Aber jener kommt ihm zuvor und wird 1971 für die erste, gewaltsam endende Geiselnahme nach einem Bankraub in der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. Anders als Todorov hat Lugmeier niemanden getötet, ist haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt."
Also zunächst einmal hat Todorov niemanden getötet.
Er wurde zum einen für angeblich in Tötungsabsicht abgegebene Schüsse bei der Stürmung der Deutschen Bank verurteilt, wobei allerdings niemand zu schaden kam und Aussage gegen Aussage stand, ob es sich tatsächlich um gezielte Schüsse gehandelt habe.
Zum zweiten wurde er dafür verurteilt, dass sein Tatgenosse Georg Rammelmaier während des Banküberfalls angeblich eine Geisel getötet habe. Die Geisel kam bei einem vom Schreiber'schen Polizeikommando begonnenen Schusswechsel ums Leben. Es wurde dabei aber für Außenstehende nie zufriedenstellend geklärt, ob es nicht etwa die Polizeikugeln waren die die Frau das Leben gekostet hatte (Bad Kleinen lässt grüßen - Die Münchner Polizei zeigte sich Anfang der 70er Jahre in vergleichbaren Situationen mehrfach völlig überfordert. Soviel nur hierzu.
-------------------
Nachträgliche Anmerkung am 20.10. 2005. Nach einem Hinweis an die Redaktion der WOZ meldete sich der Verfasser und räumte den Irrtum ein. U.a. schrieb er in einer E-Mail:
"Dein Einwurf ist richtig, ich lag falsch: Todorov hat niemand umgebracht. Es hätte in dem Text stehen müssen: An Aktionen, bei denen Lugmeiner beteiligt war, sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Das habe ich der Woz auch mitgeteilt."
-------------------
Zur politischen Dimension des Lugmeierschen Lebens
"Die mexikanische Presse bezeichnete Lugmeier seinerzeit als Anführer einer Anarchistengruppe. Seine Biografie überschneidet sich tatsächlich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte auf verblüffende Weise: Im Jahr der Gründung der Bundesrepublik, 1949, Geburt, 1977 (Deutscher Herbst) Festnahme, 1989 Entlassung, kurz vor der Wiedervereinigung. Aber Lugmeier ist nicht in dem Sinne politisch, auch wenn seine Entscheidungen oftmals von Radikalität getragen waren und prominente Linke sich mit ihm verbunden fühlten. «Geld war wichtig für mich. Es hat mir in meiner Entwicklung geholfen. Ich kam so mit anderen Gesellschaftsschichten in Berührung. Aber das war nicht die Verwirklichung meiner Träume. Ich bin durch das Geld nicht unabhängig geworden, sondern in die Rolle des Gejagten geraten.»"
vabanque - am Dienstag, 18. Oktober 2005, 11:06 - Rubrik: Biographien des Bankraubs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Wiener Kunstpolit- und Theoriegruppe Monochrom führte gemeinsam mit Johannes Ullmaier eine Geldwechselperformance durch.
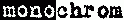
Hierbei ging es um die Frage, wie oft man Euros und US-Dollars wechseln kann, bis nichts mehr übrig geblieben ist. Hier die Performance "Die Türme von Hanoi oder never change a running system" incl. die daraus resultierende Berechnung:
Auskunft am Bankschalter: "Da verlieren sie aber."
Antwort des Bankkunden: "Das liegt in der Natur der Sache."
Wohl wahr ...
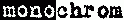
Hierbei ging es um die Frage, wie oft man Euros und US-Dollars wechseln kann, bis nichts mehr übrig geblieben ist. Hier die Performance "Die Türme von Hanoi oder never change a running system" incl. die daraus resultierende Berechnung:
Auskunft am Bankschalter: "Da verlieren sie aber."
Antwort des Bankkunden: "Das liegt in der Natur der Sache."
Wohl wahr ...
vabanque - am Sonntag, 9. Oktober 2005, 11:59 - Rubrik: Ueber Banken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Süddeutsche Zeitung (6.10 2005) hat einen langen Beitrag über Ludwigs Lugmeiers (sogar auf Seite 3) Buch "Der Mann, der aus dem Fenster sprang" beigesteuert. Autor ist Willi Winkler. Leider nicht online und wenn doch, dann wird das noch nachgereicht.
In der Schweizer Weltwoche (39/2005) findet sich ein Artikel/Gespräch(?) "Sein letzter Coup, Ehrenwort" von Arno Luik (ex-Schwäbisches Tagblatt, Tübingen) über/mit Luigi Lugmeier. Ebenfalls nicht online, aber ein Aufriss:
"Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen? Keine Frage für Ludwig Lugmeier. Der deutsche Grossgangster schrieb im Zuchthaus seine Biografie und sprach mit Arno Luik."
Arno Luiks Interview gibt es auch (oder in einer abgeänderten Version) im Stern 39/2005 (nicht online). Das Interview macht Lust auf das Buch:
"Luik: Her Lugmeier. anders als viele Jügendliche heute wussten sie schon als Kind verdammt genau, was Sie werden wollten: ein richtig großer Gangster.
Lugmeier: Das war kein Berufswunsch, es war viel mehr: eine Lebensperspektive. Ich wollte andere Räume betreten, dorthin kommen, wo die Gesetze nicht mehr gelten."
In diesem Interview finden sich erhellende Passagen:
Luik: Sie machen es sich einfach: Sie sagen, Bücher brachten micht auf die schiefe Bahn.
Lugmeier: Nein! Nein!. Für ein Gangster war mein Werdegang überhaupt nicht schief. Der ging steil nach oben und dann tief nach unten. Mein Lebensweg ist abgründig und abwegig.
Luik: Das klingt pathetisch.
Lugmeier: Nein, ich wuchs in den Fünfziger auf in ..
Ebenfalls in der Weltwoche (39/2005) und nicht online findet sich die Kritik "Schlechte Zeiten, gute Seiten" des Lugmeier-Werkes von Hans-Peter Kunisch:
"Gangster, Dompteur, Schiffsjunge: Ludwig Lugmeier lebte seine Fantasien aus. Deshalb schreibt er auch so unspiessig."
Der Literaturkritiker Kunisch veröffentlichte einen weiteren Beitrag in der September-Ausgabe von "Literaturen" als vierseitiges Portrait:
"Das Leben ist ein Abenteuerroman. Der Millionendieb und Meisterausbrecher Ludwig Lugmeier hat seine Autobiografie geschrieben. Lokalaugenschein mit Bankräuber in Kochel am Bodensee."
In diesem Artikel zeigt sich Kunisch vor allem von der sprachlichen Ausdruckskraft ("Der Räuber als Weltliterat") von Lugmeier beeindruckt und scheut sich nicht dieselbe an Horvath, Melville oder Conrad zu messen. Er spricht von "stilistischer Meisterschaft" und der Herkunft der Sprache Lugmeiers vom Expressionismus. Das Beste an dem Portrait (wie wohl des Buches insgesamt) ist allerdings, das Lugmeier nicht als Opfer seiner Lebensumstände missverstanden wird, sondern sich selbst als Akteur seines Lebens gezeigt wird.
In der Schweizer Weltwoche (39/2005) findet sich ein Artikel/Gespräch(?) "Sein letzter Coup, Ehrenwort" von Arno Luik (ex-Schwäbisches Tagblatt, Tübingen) über/mit Luigi Lugmeier. Ebenfalls nicht online, aber ein Aufriss:
"Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen? Keine Frage für Ludwig Lugmeier. Der deutsche Grossgangster schrieb im Zuchthaus seine Biografie und sprach mit Arno Luik."
Arno Luiks Interview gibt es auch (oder in einer abgeänderten Version) im Stern 39/2005 (nicht online). Das Interview macht Lust auf das Buch:
"Luik: Her Lugmeier. anders als viele Jügendliche heute wussten sie schon als Kind verdammt genau, was Sie werden wollten: ein richtig großer Gangster.
Lugmeier: Das war kein Berufswunsch, es war viel mehr: eine Lebensperspektive. Ich wollte andere Räume betreten, dorthin kommen, wo die Gesetze nicht mehr gelten."
In diesem Interview finden sich erhellende Passagen:
Luik: Sie machen es sich einfach: Sie sagen, Bücher brachten micht auf die schiefe Bahn.
Lugmeier: Nein! Nein!. Für ein Gangster war mein Werdegang überhaupt nicht schief. Der ging steil nach oben und dann tief nach unten. Mein Lebensweg ist abgründig und abwegig.
Luik: Das klingt pathetisch.
Lugmeier: Nein, ich wuchs in den Fünfziger auf in ..
Ebenfalls in der Weltwoche (39/2005) und nicht online findet sich die Kritik "Schlechte Zeiten, gute Seiten" des Lugmeier-Werkes von Hans-Peter Kunisch:
"Gangster, Dompteur, Schiffsjunge: Ludwig Lugmeier lebte seine Fantasien aus. Deshalb schreibt er auch so unspiessig."
Der Literaturkritiker Kunisch veröffentlichte einen weiteren Beitrag in der September-Ausgabe von "Literaturen" als vierseitiges Portrait:
"Das Leben ist ein Abenteuerroman. Der Millionendieb und Meisterausbrecher Ludwig Lugmeier hat seine Autobiografie geschrieben. Lokalaugenschein mit Bankräuber in Kochel am Bodensee."
In diesem Artikel zeigt sich Kunisch vor allem von der sprachlichen Ausdruckskraft ("Der Räuber als Weltliterat") von Lugmeier beeindruckt und scheut sich nicht dieselbe an Horvath, Melville oder Conrad zu messen. Er spricht von "stilistischer Meisterschaft" und der Herkunft der Sprache Lugmeiers vom Expressionismus. Das Beste an dem Portrait (wie wohl des Buches insgesamt) ist allerdings, das Lugmeier nicht als Opfer seiner Lebensumstände missverstanden wird, sondern sich selbst als Akteur seines Lebens gezeigt wird.
vabanque - am Donnerstag, 6. Oktober 2005, 14:02 - Rubrik: Biographien des Bankraubs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
erschienen. Da Lugmeier auch als Märchenerzähler reussierte, dürfte es ein Vergnügen sein, ihm zuzuhören.
Für das Hörbuch hat Lugmeier die wichtigsten Kapitel aus dem Buch selbst eingelesen.
sparkassenkunde - am Donnerstag, 6. Oktober 2005, 12:01 - Rubrik: Biographien des Bankraubs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein abenteuerliches Leben
Lorenz Schröter hat für das Deutschlandradio und den BR-Zündfunk
anlässlich des Erscheinens der Autobiographie von Ludwig Lugmeier mit dem ehemaligen Bankräuber gesprochen. Das Portrait vom 22.9. 2005 lässt sich hier auch als Audio on Demand herunterladen:
"Ludwig Lugmeier tritt heute als Märchenerzähler auf. Vor 25 Jahren überfiel er zwei Geldtransporte und erbeutete mehrere Millionen Mark. Dabei sollte er Maurer werden wie sein Vater. Doch er hatte einen Bibliotheksausweis und las von der großen weiten Welt jenseits Oberbayerns und den herrlichen Abenteuern darin.
Ich habe Banken überfallen, weil es last not least auch eine Herausforderung war.
Ludwig Lugmeier sieht eigentlich ganz gemütlich aus mit seinem Schnurrbart, der stämmigen Figur und dem Strohhut über der Halbglatze. Doch vor 25 Jahren überfiel er zwei Geldtransporte und erbeutete zweieinhalb Millionen Mark. Dabei sollte er Maurer werden wie sein Vater. Doch er hatte einen Bibliotheksausweis und las von der großen weiten Welt jenseits Oberbayerns und den herrlichen Abenteuern darin.
In erster Linie Piratenbücher der Rote Freibeuter, den habe ich mit Begeisterung verschlungen, denn dieses Piratenleben, frei auf offener See. Das hätte mir schon sehr gut gefallen.
Also bricht er in einen Supermarkt ein, wird geschnappt und statt ein Geständnis abzulegen und mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen, hält er es mit seinen Romanhelden und schweigt eisern.
Ich war 15, knapp 16 und in der Jugendstrafanstalt, und eigentlich wollte ich da auch drin sein. Das Gefängnis ist für mich eine Art Station gewesen, von der man aus ein neues, abenteuerliches Leben beginnen kann, und dort ist mir jemand begegnet, ein Italiener, der mir gesagt hat, dass es in Palermo Anwerbestellen der Mafia gibt.
Der junge Lugmeier flieht aus dem Gefängnis, trampt nach Italien, aber findet die Mafia nicht. Auf dem Rückweg heuert er bei einem Wanderzirkus an. Eines Tages, der Mann der normalerweise mit dem Bären kämpft war auf einer Sauftour verschwunden, bekommt Lugmeier seine Chance und er darf mit dem Bären kämpfen. Doch dann fordert er mehr vom Leben.
"Der Überfall selbst hatte eine lange Vorbereitung gefordert. Denn dieses Viertel in Frankfurt, das ist fast wie eine Art Labyrinth angelegt. Es gab so gut wie keine Möglichkeit von dort aus zu fliehen. Und da haben wir sehr, sehr lange danach gesucht, bis ich schließlich auf den Einfall kam, dass wir genau zu dieser Stelle zurück müssen, wo der Überfall gelaufen sei, dort erwarte man uns nicht. Und von dort aus die Flucht in die entgegengesetzte Richtung nehmen. Denn so wie man selbst, wenn man zu fliehen versucht, natürlich wegkommen will, rechnet die Polizei damit, dass derjenige auch wegzukommen versucht und nicht, dass er dort wieder an die Stelle zurückkehrt wo der Gefahrenpunkt ist."
Nach ein paar Monaten wurde Ludwig Lugmeier geschnappt und tat den Satz seines Lebens, der ihn berühmt machte: Am 4. Februar 76 nutzte er ein offenes Fenster im Gerichtsaal, knallte auf das harte Pflaster Frankfurts und rannte um sein Leben. Zwei Jahre war er auf der Flucht, England, Mexiko, Istanbul, Island, Bahamas, überall wo es Casinos gab.
"Ich habe sehr viel im Roulett verloren. Es war nicht ganz eine Million, aber es hat nicht mehr viel gefehlt dazu.
"Das war sicher von der ganzen Geschichte der Spannendste, denn der Rouletttisch ist jener Platz, jener Ort in der Welt, in dem sich das Glück zentriert und wo man direkt auf den Punkt der eigenen Existenz als Glücksspieler beheimatet ist."
Nach zwei Jahren war Lugmeiers Flucht zu Ende. Er wird zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. In Straubing sitzt er mit dem Oetker-Entführer und RAF-Mitgliedern ein. Dort fängt seine zweite Karriere an.
"Ich hab im Gefängnis mich zurückgezogen. Ich hab geschrieben. Viel gelesen. Über fast 10 Jahre lang die Arbeit verweigert."
Nach seiner Entlassung arbeitet er als fest angestellter Märchenerzähler in einer Ostberliner Stadtbibliothek. Sein Arbeitgeber und die Kinder ahnen nicht, dass der nette Onkel, der ihnen den Räuber Hotzenplotz vorliest, selbst mal ein gefährlicher Räuber war.
Straffällig ist Lugmeier nicht mehr geworden. Die Literatur, die ihn einst auf die schiefe Bahn gebracht hat, rettet ihn zum Schluss auch wieder.
"Was heißt die schiefe Bahn? Es war auf jeden Fall nicht der vorgezeichnete Lebensweg, ich bin so gesehen ganz froh, das ich den nicht gegangen bin, wahrscheinlich wäre ich dann schon längst erstickt."
Und vielleicht gab es unter seinen Zuhörern ein romantisches, wildes Kind wie Ludwig es einmal war oder ein Leser wird Lugmeiers spannendes Buch zuklappen und mit feurigen Wangen sagen: Ja, auch ich will abenteuerliches Leben führen.
"Ich denke, jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Wer eine Bank überfallen will, soll sie von mir aus überfallen, aber bitte, er soll sich nicht auf mich berufen. Der soll schon selbst dafür einstehen, was er macht."
--------------------------------------------
Für den BR-Zündfunk (16.9. 2005) spricht Lorenz Schröter mit Ludwig Lugmeier über den Überfall auf den Geldtransporter in Frankfurt, seine Flucht durch zahlreiche Länder und über seinen Gefängnisaufenthalt gesprochen. Hier die "Täterbeschreibung:
"Früher raubte er Banken aus, überfiel Geldtransporte und flüchtete jahrelang vor der Polizei. Heute lebt Ludwig Lugmeier als Schriftsteller und Märchenerzähler in Berlin. Nächste Woche erscheint sein neues Buch.
"Ich habe versucht mich bei der Mafia zu bewerben. Ich war 15, knapp 16 und in der Jugendstrafanstalt. Ich habe dort meine erste Jugendstrafe abgesessen und eigentlich wollte ich da auch drin sein. Das Gefängnis ist für mich eine Art Station gewesen, von der aus man ein neues, abenteuerliches Leben beginnen kann. Dort ist mir jemand begegnet, ein Italiener, der mir gesagt hat, dass es in Palermo Anwerbestellen der Mafia gibt." (Ludwig Lugmeier)
Ludwig Lugmeier stammt vom Kochelsee, sein Vater war Maurer und das sollte auch er werden. Doch der kleine Ludwig hatte einen Bibliotheksausweis. Dort hat er sich Bücher gesucht, die zu ihm passten, vor allem Piratenbücher, wie der Rote Freibeuter. Das Piratenleben, frei und auf offener See, das war war seine Sehnsucht.
"Und ich bin daraufhin vom Torfstich, wo ich gearbeitet habe, abgehauen und habe mich auf den Weg gemacht nach Palermo und bin da auch hingekommen und habe dort nach der Anwerbestelle der Mafia gesucht. Habe lange gesucht und gefragt und einen Zettel geschrieben, auf dem Mafia mit "?" stand. Aber die Anwerbestelle habe ich nicht gefunden und so bin ich halt nie Mafioso geworden. Bin wieder zurückgekehrt und Mafia-frei geblieben." (Ludwig Lugmeier)
Heute ist Lugmeier Schriftsteller und Märchenerzähler. In der Ostberliner Stadtbibliothek wusste niemand, dass der knuffige Onkel mit dem komischen Räuber-Hotzenplotz-Dialekt früher einmal ein gefährlicher Räuber war. Dabei hatte er am Anfang Angst davor, einer Horde 5jähriger Geschichten zu erzählen."
"Da wusste ich nicht so recht wie ich das machen soll. Da habe ich aber nach drei Sätzen gemerkt, ich muss einfach nur erzählen, wie ich erzählen kann. Und die Geschichten so erzählen, wie sie sich in meinem Kopf zutragen, wie sie ablaufen. Dann habe ich auf einmal gemerkt, wie die alle ganz fasziniert da saßen und mir zugehört haben. Und dann habe ich drei Jahre lang Märchen und Geschichten erzählt." (Ludwig Lugmeier)
Eine wesentlich längere Version hiervon findet sich beim (
Lorenz Schröter hat für das Deutschlandradio und den BR-Zündfunk
anlässlich des Erscheinens der Autobiographie von Ludwig Lugmeier mit dem ehemaligen Bankräuber gesprochen. Das Portrait vom 22.9. 2005 lässt sich hier auch als Audio on Demand herunterladen:
"Ludwig Lugmeier tritt heute als Märchenerzähler auf. Vor 25 Jahren überfiel er zwei Geldtransporte und erbeutete mehrere Millionen Mark. Dabei sollte er Maurer werden wie sein Vater. Doch er hatte einen Bibliotheksausweis und las von der großen weiten Welt jenseits Oberbayerns und den herrlichen Abenteuern darin.
Ich habe Banken überfallen, weil es last not least auch eine Herausforderung war.
Ludwig Lugmeier sieht eigentlich ganz gemütlich aus mit seinem Schnurrbart, der stämmigen Figur und dem Strohhut über der Halbglatze. Doch vor 25 Jahren überfiel er zwei Geldtransporte und erbeutete zweieinhalb Millionen Mark. Dabei sollte er Maurer werden wie sein Vater. Doch er hatte einen Bibliotheksausweis und las von der großen weiten Welt jenseits Oberbayerns und den herrlichen Abenteuern darin.
In erster Linie Piratenbücher der Rote Freibeuter, den habe ich mit Begeisterung verschlungen, denn dieses Piratenleben, frei auf offener See. Das hätte mir schon sehr gut gefallen.
Also bricht er in einen Supermarkt ein, wird geschnappt und statt ein Geständnis abzulegen und mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen, hält er es mit seinen Romanhelden und schweigt eisern.
Ich war 15, knapp 16 und in der Jugendstrafanstalt, und eigentlich wollte ich da auch drin sein. Das Gefängnis ist für mich eine Art Station gewesen, von der man aus ein neues, abenteuerliches Leben beginnen kann, und dort ist mir jemand begegnet, ein Italiener, der mir gesagt hat, dass es in Palermo Anwerbestellen der Mafia gibt.
Der junge Lugmeier flieht aus dem Gefängnis, trampt nach Italien, aber findet die Mafia nicht. Auf dem Rückweg heuert er bei einem Wanderzirkus an. Eines Tages, der Mann der normalerweise mit dem Bären kämpft war auf einer Sauftour verschwunden, bekommt Lugmeier seine Chance und er darf mit dem Bären kämpfen. Doch dann fordert er mehr vom Leben.
"Der Überfall selbst hatte eine lange Vorbereitung gefordert. Denn dieses Viertel in Frankfurt, das ist fast wie eine Art Labyrinth angelegt. Es gab so gut wie keine Möglichkeit von dort aus zu fliehen. Und da haben wir sehr, sehr lange danach gesucht, bis ich schließlich auf den Einfall kam, dass wir genau zu dieser Stelle zurück müssen, wo der Überfall gelaufen sei, dort erwarte man uns nicht. Und von dort aus die Flucht in die entgegengesetzte Richtung nehmen. Denn so wie man selbst, wenn man zu fliehen versucht, natürlich wegkommen will, rechnet die Polizei damit, dass derjenige auch wegzukommen versucht und nicht, dass er dort wieder an die Stelle zurückkehrt wo der Gefahrenpunkt ist."
Nach ein paar Monaten wurde Ludwig Lugmeier geschnappt und tat den Satz seines Lebens, der ihn berühmt machte: Am 4. Februar 76 nutzte er ein offenes Fenster im Gerichtsaal, knallte auf das harte Pflaster Frankfurts und rannte um sein Leben. Zwei Jahre war er auf der Flucht, England, Mexiko, Istanbul, Island, Bahamas, überall wo es Casinos gab.
"Ich habe sehr viel im Roulett verloren. Es war nicht ganz eine Million, aber es hat nicht mehr viel gefehlt dazu.
"Das war sicher von der ganzen Geschichte der Spannendste, denn der Rouletttisch ist jener Platz, jener Ort in der Welt, in dem sich das Glück zentriert und wo man direkt auf den Punkt der eigenen Existenz als Glücksspieler beheimatet ist."
Nach zwei Jahren war Lugmeiers Flucht zu Ende. Er wird zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. In Straubing sitzt er mit dem Oetker-Entführer und RAF-Mitgliedern ein. Dort fängt seine zweite Karriere an.
"Ich hab im Gefängnis mich zurückgezogen. Ich hab geschrieben. Viel gelesen. Über fast 10 Jahre lang die Arbeit verweigert."
Nach seiner Entlassung arbeitet er als fest angestellter Märchenerzähler in einer Ostberliner Stadtbibliothek. Sein Arbeitgeber und die Kinder ahnen nicht, dass der nette Onkel, der ihnen den Räuber Hotzenplotz vorliest, selbst mal ein gefährlicher Räuber war.
Straffällig ist Lugmeier nicht mehr geworden. Die Literatur, die ihn einst auf die schiefe Bahn gebracht hat, rettet ihn zum Schluss auch wieder.
"Was heißt die schiefe Bahn? Es war auf jeden Fall nicht der vorgezeichnete Lebensweg, ich bin so gesehen ganz froh, das ich den nicht gegangen bin, wahrscheinlich wäre ich dann schon längst erstickt."
Und vielleicht gab es unter seinen Zuhörern ein romantisches, wildes Kind wie Ludwig es einmal war oder ein Leser wird Lugmeiers spannendes Buch zuklappen und mit feurigen Wangen sagen: Ja, auch ich will abenteuerliches Leben führen.
"Ich denke, jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Wer eine Bank überfallen will, soll sie von mir aus überfallen, aber bitte, er soll sich nicht auf mich berufen. Der soll schon selbst dafür einstehen, was er macht."
--------------------------------------------
Für den BR-Zündfunk (16.9. 2005) spricht Lorenz Schröter mit Ludwig Lugmeier über den Überfall auf den Geldtransporter in Frankfurt, seine Flucht durch zahlreiche Länder und über seinen Gefängnisaufenthalt gesprochen. Hier die "Täterbeschreibung:
"Früher raubte er Banken aus, überfiel Geldtransporte und flüchtete jahrelang vor der Polizei. Heute lebt Ludwig Lugmeier als Schriftsteller und Märchenerzähler in Berlin. Nächste Woche erscheint sein neues Buch.
"Ich habe versucht mich bei der Mafia zu bewerben. Ich war 15, knapp 16 und in der Jugendstrafanstalt. Ich habe dort meine erste Jugendstrafe abgesessen und eigentlich wollte ich da auch drin sein. Das Gefängnis ist für mich eine Art Station gewesen, von der aus man ein neues, abenteuerliches Leben beginnen kann. Dort ist mir jemand begegnet, ein Italiener, der mir gesagt hat, dass es in Palermo Anwerbestellen der Mafia gibt." (Ludwig Lugmeier)
Ludwig Lugmeier stammt vom Kochelsee, sein Vater war Maurer und das sollte auch er werden. Doch der kleine Ludwig hatte einen Bibliotheksausweis. Dort hat er sich Bücher gesucht, die zu ihm passten, vor allem Piratenbücher, wie der Rote Freibeuter. Das Piratenleben, frei und auf offener See, das war war seine Sehnsucht.
"Und ich bin daraufhin vom Torfstich, wo ich gearbeitet habe, abgehauen und habe mich auf den Weg gemacht nach Palermo und bin da auch hingekommen und habe dort nach der Anwerbestelle der Mafia gesucht. Habe lange gesucht und gefragt und einen Zettel geschrieben, auf dem Mafia mit "?" stand. Aber die Anwerbestelle habe ich nicht gefunden und so bin ich halt nie Mafioso geworden. Bin wieder zurückgekehrt und Mafia-frei geblieben." (Ludwig Lugmeier)
Heute ist Lugmeier Schriftsteller und Märchenerzähler. In der Ostberliner Stadtbibliothek wusste niemand, dass der knuffige Onkel mit dem komischen Räuber-Hotzenplotz-Dialekt früher einmal ein gefährlicher Räuber war. Dabei hatte er am Anfang Angst davor, einer Horde 5jähriger Geschichten zu erzählen."
"Da wusste ich nicht so recht wie ich das machen soll. Da habe ich aber nach drei Sätzen gemerkt, ich muss einfach nur erzählen, wie ich erzählen kann. Und die Geschichten so erzählen, wie sie sich in meinem Kopf zutragen, wie sie ablaufen. Dann habe ich auf einmal gemerkt, wie die alle ganz fasziniert da saßen und mir zugehört haben. Und dann habe ich drei Jahre lang Märchen und Geschichten erzählt." (Ludwig Lugmeier)
Eine wesentlich längere Version hiervon findet sich beim (
sparkassenkunde - am Donnerstag, 6. Oktober 2005, 11:23 - Rubrik: Biographien des Bankraubs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ludwig Lugmeier hat eine Autobiographie verfasst:

Ludwig Lugmeier: Der Mann, der aus dem Fenster sprang
Ein Leben zwischen Flucht und Angriff
ISBN 3-88897-401-1, 19.90 EUR
Antje Kunstmann Verlag
Lesetermine lassen sich bei Tom Produkt buchen.
Bisherige Termine:
Di. 11.10.05 Berlin, Festsaal Kreuzberg
Fr. 21.10.05 Frankfurt, Club Voltaire
Fr. 09.12.05 Berlin, Eiszeit-Kino
Do. 09.02.06 Göttingen, Literarisches Zentrum
Fr. 10.02.06 Bielefeld, Kamp
Mi. 19.04.06 Passau, Scheune am Severinstor
Hier der Promotion-Text:
"Ludwig Lugmeier, geboren 1949 in Kochel am See, wollte schon als Kind der neu aufkommenden deutschen Biederkeit entfliehen. Als er mit fünfzehn ins Gefängnis kam, hatte er sein Ziel zum ersten Mal erreicht. Mit Überfällen auf Geldtransporte erwarb er sich schon bald darauf einen legendären Ruf. 1976 schrieb die gesamte deutsche Presse über ihn, nachdem er während seines Frankfurter Prozesses durch einen Sprung aus dem Fenster des Gerichtssaals entkommen war.

Lugmeier schildert sein Leben als einer, dem Un-recht die Voraussetzung der eigenen Geschichte ist. Sie überzeugt in ihren rasanten Wechseln von Angriff und Flucht, Überfluss und Armut, Gefängniszellen und Triumph der Freiheit als radikale, lakonisch und drängend erzählte Selbstvergewisserung. Nach seinem 1992 erschienenen Roman »Wo der Hund begraben ist«, einem Sittengemälde aus dem Oberbayern der Nachkriegszeit, sichert sich Lugmeier damit endgültig einen markanten Platz im »unfriedlichen Reich« der Literatur.
1993 hatte das SZ-Magazin Ludwig Lugmeier gefragt: »Warum haben Sie über Ihre Erlebnisse als Millionendieb oder über das Gefängnisleben noch nicht geschrieben?« Seine Antwort lautete damals noch: »Dazu habe ich noch viel zu wenig Abstand. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich das machen werde, schon allein deshalb, weil ich die zwei Bilder, die von mir in der Öffentlichkeit existieren – Gangster und Schriftsteller –, literarisch vereinen möchte.«
Seine Raubüberfälle galten als die spektakulärsten der deutschen Nachkriegszeit. Knapp 30 Jahre nach dem legendären Fenstersprung bei seinem Frankfurter Prozess erzählt Ludwig Lugmeier nun seine Geschichte."
Tilmann Jens portraitierte Lugmeier im Kontext des Erscheinens von Eduard Zimmermanns Autobiographie "Auch ich war ein Gauner" in Titel Thesen Temperamente (HR) am 18.09.2005. Tilmann Jens' legt den Schluss nahe, dass Lugmeier das größere Format gehabt habe. Ein Einschätzung, der wir uns voll und ganz anschließen. Zudem zeigt das Doppelportrait nochmals auf, wie nahe sich Krimineller und Kriminaler sind. Deshalb wird dieses Feature im Kulturzeit-Lesetip (3sat) auch mit der Überschrift "Zwei Gauner und ihr Leben" zweitverwertet.
"Mit einer Ausgabe von xy begann 1974 eine richtig große Gangster-Geschichte. Eduard Zimmermann suchte einen bayerischen Räuber, der für Schlagzeilen sorgen sollte. Vor dem schweren Jungen mit den grünen Augen war kein Geldtransporter gefeit. Über zwei Millionen Mark hat er mit seiner Gang erbeutet. Angst hatte der heute 56-Jährige nur vor einem - erraten, vor Eduard Zimmermann! Vor ihm floh er in den Stadtwald.
Gradlinig ist der Mann, der in diesem Frankfurter Gerichtssaal verurteilt wurde, auf die schiefe Bahn geraten. Jetzt hat er sein wildbewegtes Leben aufgeschrieben. Seine erste Verurteilung mit 16 kommentiert er mit den Worten: „Endlich hatte ich es geschafft, hatte mich von einem erbärmlichen Mauerlehrling in einen echten Sträfling verwandelt.“
Er war soviel mehr als nur ein schnöder Panzer-Knacker. Als Virtuose der Verkleidung hat er seine Raubüberfälle zur Kunstform erhoben… und war auf der Flucht Eduard Zimmermann und auch Interpol fast immer um Längen voraus. Selbst seine spektakuläre Verhaftung konnte ihn nicht dauerhaft stoppen. Aus dem Fenster eines Frankfurter Gerichtsaales ist er 1976 in die Freiheit gesprungen, aus fünf Metern Höhe. Die todesmutige Nummer sorgte in ganz Deuschland für Aufsehen und gab seinem Buch den Namen: „Der Mann, der aus dem Fenster sprang“.
Wie lebt es sich als Berufsverbrecher? Lugmeier erzählt davon, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt zu einem einzigen Unterschlupf wird, von Bars und Bordellen bis hin nach Mexiko, die aber nicht ablenken können von der Angst, am Ende doch entdeckt zu werden. Freude aber kommt auf, wenn er in der Ferne an die alten Gegenspieler denkt, die, wie Ede Zimmermann, wieder einmal auf falschen Fährten tappen.
Doch Stopp! Was müssen wir da lesen? Ede war selbst ein Krimineller. Ausgerechnet er! Lugmeier, der dann doch bis 1989 im Knast saß, kann es nicht fassen. Eduard Zimmermann: ein Berufskollege. Und auch er versucht nun an einer Lebensbeichte. In der Nachkriegszeit habe er Brotmarken geklaut, Schwarzmarktgeschäfte getätigt, Urkunden gefälscht.
Heute ist er 76, ein reicher Medienunternehmer. An xy verdient er noch immer, der Mann, von dem wir nun wissen, dass auch er im Knast saß, fünf Jahre in Ost und West im Knast saß. Können wir denn niemandem mehr trauen?
Ein Grosser also hätte er werden können, sagt er. Hätte! Heute sitzt er neben Otto Schily, zwei Freunde von Recht und Ordnung. Von Ludwig Lugmeier kritisch beobachtet, haben die beiden am Dienstag in Berlin gemeinsam den xy-Preis verliehen. Die Zeit der ideologischen Differenzen scheint vergessen, vorbei.
Sie haben beide ihren Frieden mit ihrer Vergangenheit gemacht. Und so entstand ein dickes Buch von Ede, ohne Widersprüche, ohne Zweifel, ohne Not. Das findet auch Ludwig Lugmeier, der enttäuscht ist von den Erinnerungen seines alten Gegenspielers.
Lugmeier war nicht nur als von Eduard Zimmermann gesuchter Ganove ein anderes Kaliber. Der kann erzählen vom Verbrechen und vom Gefühl, wie das ist gejagt zu werden. Spätestens seit diesem Herbst ist er ein wirklich grosser Schriftsteller: Er hat den Absprung geschafft, der Mann, der aus dem Fenster sprang."

Ludwig Lugmeier: Der Mann, der aus dem Fenster sprang
Ein Leben zwischen Flucht und Angriff
ISBN 3-88897-401-1, 19.90 EUR
Antje Kunstmann Verlag
Lesetermine lassen sich bei Tom Produkt buchen.
Bisherige Termine:
Di. 11.10.05 Berlin, Festsaal Kreuzberg
Fr. 21.10.05 Frankfurt, Club Voltaire
Fr. 09.12.05 Berlin, Eiszeit-Kino
Do. 09.02.06 Göttingen, Literarisches Zentrum
Fr. 10.02.06 Bielefeld, Kamp
Mi. 19.04.06 Passau, Scheune am Severinstor
Hier der Promotion-Text:
"Ludwig Lugmeier, geboren 1949 in Kochel am See, wollte schon als Kind der neu aufkommenden deutschen Biederkeit entfliehen. Als er mit fünfzehn ins Gefängnis kam, hatte er sein Ziel zum ersten Mal erreicht. Mit Überfällen auf Geldtransporte erwarb er sich schon bald darauf einen legendären Ruf. 1976 schrieb die gesamte deutsche Presse über ihn, nachdem er während seines Frankfurter Prozesses durch einen Sprung aus dem Fenster des Gerichtssaals entkommen war.

Lugmeier schildert sein Leben als einer, dem Un-recht die Voraussetzung der eigenen Geschichte ist. Sie überzeugt in ihren rasanten Wechseln von Angriff und Flucht, Überfluss und Armut, Gefängniszellen und Triumph der Freiheit als radikale, lakonisch und drängend erzählte Selbstvergewisserung. Nach seinem 1992 erschienenen Roman »Wo der Hund begraben ist«, einem Sittengemälde aus dem Oberbayern der Nachkriegszeit, sichert sich Lugmeier damit endgültig einen markanten Platz im »unfriedlichen Reich« der Literatur.
1993 hatte das SZ-Magazin Ludwig Lugmeier gefragt: »Warum haben Sie über Ihre Erlebnisse als Millionendieb oder über das Gefängnisleben noch nicht geschrieben?« Seine Antwort lautete damals noch: »Dazu habe ich noch viel zu wenig Abstand. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich das machen werde, schon allein deshalb, weil ich die zwei Bilder, die von mir in der Öffentlichkeit existieren – Gangster und Schriftsteller –, literarisch vereinen möchte.«
Seine Raubüberfälle galten als die spektakulärsten der deutschen Nachkriegszeit. Knapp 30 Jahre nach dem legendären Fenstersprung bei seinem Frankfurter Prozess erzählt Ludwig Lugmeier nun seine Geschichte."
Tilmann Jens portraitierte Lugmeier im Kontext des Erscheinens von Eduard Zimmermanns Autobiographie "Auch ich war ein Gauner" in Titel Thesen Temperamente (HR) am 18.09.2005. Tilmann Jens' legt den Schluss nahe, dass Lugmeier das größere Format gehabt habe. Ein Einschätzung, der wir uns voll und ganz anschließen. Zudem zeigt das Doppelportrait nochmals auf, wie nahe sich Krimineller und Kriminaler sind. Deshalb wird dieses Feature im Kulturzeit-Lesetip (3sat) auch mit der Überschrift "Zwei Gauner und ihr Leben" zweitverwertet.
"Mit einer Ausgabe von xy begann 1974 eine richtig große Gangster-Geschichte. Eduard Zimmermann suchte einen bayerischen Räuber, der für Schlagzeilen sorgen sollte. Vor dem schweren Jungen mit den grünen Augen war kein Geldtransporter gefeit. Über zwei Millionen Mark hat er mit seiner Gang erbeutet. Angst hatte der heute 56-Jährige nur vor einem - erraten, vor Eduard Zimmermann! Vor ihm floh er in den Stadtwald.
Gradlinig ist der Mann, der in diesem Frankfurter Gerichtssaal verurteilt wurde, auf die schiefe Bahn geraten. Jetzt hat er sein wildbewegtes Leben aufgeschrieben. Seine erste Verurteilung mit 16 kommentiert er mit den Worten: „Endlich hatte ich es geschafft, hatte mich von einem erbärmlichen Mauerlehrling in einen echten Sträfling verwandelt.“
Er war soviel mehr als nur ein schnöder Panzer-Knacker. Als Virtuose der Verkleidung hat er seine Raubüberfälle zur Kunstform erhoben… und war auf der Flucht Eduard Zimmermann und auch Interpol fast immer um Längen voraus. Selbst seine spektakuläre Verhaftung konnte ihn nicht dauerhaft stoppen. Aus dem Fenster eines Frankfurter Gerichtsaales ist er 1976 in die Freiheit gesprungen, aus fünf Metern Höhe. Die todesmutige Nummer sorgte in ganz Deuschland für Aufsehen und gab seinem Buch den Namen: „Der Mann, der aus dem Fenster sprang“.
Wie lebt es sich als Berufsverbrecher? Lugmeier erzählt davon, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt zu einem einzigen Unterschlupf wird, von Bars und Bordellen bis hin nach Mexiko, die aber nicht ablenken können von der Angst, am Ende doch entdeckt zu werden. Freude aber kommt auf, wenn er in der Ferne an die alten Gegenspieler denkt, die, wie Ede Zimmermann, wieder einmal auf falschen Fährten tappen.
Doch Stopp! Was müssen wir da lesen? Ede war selbst ein Krimineller. Ausgerechnet er! Lugmeier, der dann doch bis 1989 im Knast saß, kann es nicht fassen. Eduard Zimmermann: ein Berufskollege. Und auch er versucht nun an einer Lebensbeichte. In der Nachkriegszeit habe er Brotmarken geklaut, Schwarzmarktgeschäfte getätigt, Urkunden gefälscht.
Heute ist er 76, ein reicher Medienunternehmer. An xy verdient er noch immer, der Mann, von dem wir nun wissen, dass auch er im Knast saß, fünf Jahre in Ost und West im Knast saß. Können wir denn niemandem mehr trauen?
Ein Grosser also hätte er werden können, sagt er. Hätte! Heute sitzt er neben Otto Schily, zwei Freunde von Recht und Ordnung. Von Ludwig Lugmeier kritisch beobachtet, haben die beiden am Dienstag in Berlin gemeinsam den xy-Preis verliehen. Die Zeit der ideologischen Differenzen scheint vergessen, vorbei.
Sie haben beide ihren Frieden mit ihrer Vergangenheit gemacht. Und so entstand ein dickes Buch von Ede, ohne Widersprüche, ohne Zweifel, ohne Not. Das findet auch Ludwig Lugmeier, der enttäuscht ist von den Erinnerungen seines alten Gegenspielers.
Lugmeier war nicht nur als von Eduard Zimmermann gesuchter Ganove ein anderes Kaliber. Der kann erzählen vom Verbrechen und vom Gefühl, wie das ist gejagt zu werden. Spätestens seit diesem Herbst ist er ein wirklich grosser Schriftsteller: Er hat den Absprung geschafft, der Mann, der aus dem Fenster sprang."
sparkassenkunde - am Donnerstag, 6. Oktober 2005, 10:52 - Rubrik: Biographien des Bankraubs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
In der Bremenausgabe der taz (5.10. 2005) wird über einen Prozess gegen einen Bremer Bankräuber berichtet. Dieter-Bohlen-Masken wurden auch bei anderer Gelegenheit gewünscht oder verwendet.
Aber wo kommen wir eigentlich hin, wenn hier jeder durchschnittliche Banküberfall als "filmreif" ausgegeben wird. Überhaupt enthält der Artikel in komprimierter Form alle zentralen Diskurs-Elemente der Bankraub-Folklore: Anfänger, Lottospielen, "wie im Fernsehen", "besser-leben-wollen" usw.:
Dieter Bohlen, kein böser Scherz
Seit gestern muss sich ein Arbeitsloser vor dem Bremer Landgericht verantworten, weil er in einer filmreifen Szene die Sparkasse in Horn-Lehe überfallen hat. Gutachter: "Unreife Persönlichkeit"
"Anfangs habe ich das nicht für voll genommen." Beate K. schüttelt den Kopf. Es ist der 18. Mai 2005, die Sparkassen-Filiale in der Kopernikusstraße 69 öffnet soeben ihre Pforten. An der 42-Jährigen stürmt ein Mann im ballonseidenen Jogging-Anzug vorbei, vor dem Gesicht eine Papiermaske mit dem Gesicht von Dieter Bohlen. "Ich dachte an einen bösen Scherz", erinnert sich die Hausfrau.
Aber Renee D. meinte es ernst. Mit einem Gasrevolver bewaffnet fordert er die Herausgabe des Geldes, 1.000 Euro bekommt er schließlich ausgehändigt, in kleinen Scheinen. Mehr hat auch die Bank nicht parat. Zehn Minuten später wird der Bankräuber festgenommen, seit gestern muss er sich wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Landgericht verantworten.
"Es ist genau so abgelaufen, wie man es aus dem Fernsehen kennt", erzählt Marcus G., Bankangestellter im grauen Anzug, "ganz klassisch". Doch D. ist kein abgebrühter Krimineller. Mit tränenerstickter Stimme sagt der unscheinbare 29-Jährige vor Gericht aus, immer wieder schlägt er die Hände vor dem Gesicht zusammen, rutscht nervös auf seinem Stuhl hin und her. "Ich bin davon ausgegangen, dass das auf jeden Fall klappt." Klar habe er gewusst, dass die Bank videoüberwacht wird. "Aber ich hatte ja die Maske." Und eine Perücke vom Flohmarkt, eine Wollmütze, dazu ein paar Einweghandschuhe aus dem Verbandskasten im Auto. Über die mögliche Beute machte er sich vorher keine großen Gedanken. "Ein paar tausend liegen doch da immer."
Eine unreife Persönlichkeit wird der Psychiater Martin Heinze das später nennen. Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten hegt er jedoch keine. "Er wollte seinem Selbstbild als Versager etwas entgegensetzen", schreibt der Sachverständige in seinem Gutachten.
Größere Geldsorgen hatte der arbeitslose KFZ-Mechaniker keine, auch der Kühlschrank war nicht leer. "Aber ich wollte besser leben", sagt D. vage - die Wohnung renovieren, die Rechnung für sein kaputtes Auto abbezahlen, sich selbstständig machen. Als Immobilienmakler vielleicht, oder mit einer Autowaschanlage. "Ich hatte alles mögliche vor. Das Beste sollte es dann werden." Das alles aber hätte Geld gekostet. Arbeitslosengeld II reichte da nicht aus, auch exzessives Lotto-Spielen half nicht weiter. Selbst die kleine Lebensversicherung war schon geplündert - "da kam ich auf die Idee, eine Bank zu überfallen".
Rund eine Handvoll Banküberfälle verzeichnet die bremische Polizeistatistik in jedem Jahr. "Ich habe nicht daran geglaubt, dass heute überhaupt noch Banken überfallen werden", wundert sich der Zeuge aus der Sparkasse. Renee D. drohen fünf Jahre Gefängnis, ein Jahr auf Bewährung, falls das Gericht den Fall als minderschwer einstuft und Therapie statt Knast verordnet. Am Donnerstag wird mit einem Urteil gerechnet."
Aber wo kommen wir eigentlich hin, wenn hier jeder durchschnittliche Banküberfall als "filmreif" ausgegeben wird. Überhaupt enthält der Artikel in komprimierter Form alle zentralen Diskurs-Elemente der Bankraub-Folklore: Anfänger, Lottospielen, "wie im Fernsehen", "besser-leben-wollen" usw.:
Dieter Bohlen, kein böser Scherz
Seit gestern muss sich ein Arbeitsloser vor dem Bremer Landgericht verantworten, weil er in einer filmreifen Szene die Sparkasse in Horn-Lehe überfallen hat. Gutachter: "Unreife Persönlichkeit"
"Anfangs habe ich das nicht für voll genommen." Beate K. schüttelt den Kopf. Es ist der 18. Mai 2005, die Sparkassen-Filiale in der Kopernikusstraße 69 öffnet soeben ihre Pforten. An der 42-Jährigen stürmt ein Mann im ballonseidenen Jogging-Anzug vorbei, vor dem Gesicht eine Papiermaske mit dem Gesicht von Dieter Bohlen. "Ich dachte an einen bösen Scherz", erinnert sich die Hausfrau.
Aber Renee D. meinte es ernst. Mit einem Gasrevolver bewaffnet fordert er die Herausgabe des Geldes, 1.000 Euro bekommt er schließlich ausgehändigt, in kleinen Scheinen. Mehr hat auch die Bank nicht parat. Zehn Minuten später wird der Bankräuber festgenommen, seit gestern muss er sich wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Landgericht verantworten.
"Es ist genau so abgelaufen, wie man es aus dem Fernsehen kennt", erzählt Marcus G., Bankangestellter im grauen Anzug, "ganz klassisch". Doch D. ist kein abgebrühter Krimineller. Mit tränenerstickter Stimme sagt der unscheinbare 29-Jährige vor Gericht aus, immer wieder schlägt er die Hände vor dem Gesicht zusammen, rutscht nervös auf seinem Stuhl hin und her. "Ich bin davon ausgegangen, dass das auf jeden Fall klappt." Klar habe er gewusst, dass die Bank videoüberwacht wird. "Aber ich hatte ja die Maske." Und eine Perücke vom Flohmarkt, eine Wollmütze, dazu ein paar Einweghandschuhe aus dem Verbandskasten im Auto. Über die mögliche Beute machte er sich vorher keine großen Gedanken. "Ein paar tausend liegen doch da immer."
Eine unreife Persönlichkeit wird der Psychiater Martin Heinze das später nennen. Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten hegt er jedoch keine. "Er wollte seinem Selbstbild als Versager etwas entgegensetzen", schreibt der Sachverständige in seinem Gutachten.
Größere Geldsorgen hatte der arbeitslose KFZ-Mechaniker keine, auch der Kühlschrank war nicht leer. "Aber ich wollte besser leben", sagt D. vage - die Wohnung renovieren, die Rechnung für sein kaputtes Auto abbezahlen, sich selbstständig machen. Als Immobilienmakler vielleicht, oder mit einer Autowaschanlage. "Ich hatte alles mögliche vor. Das Beste sollte es dann werden." Das alles aber hätte Geld gekostet. Arbeitslosengeld II reichte da nicht aus, auch exzessives Lotto-Spielen half nicht weiter. Selbst die kleine Lebensversicherung war schon geplündert - "da kam ich auf die Idee, eine Bank zu überfallen".
Rund eine Handvoll Banküberfälle verzeichnet die bremische Polizeistatistik in jedem Jahr. "Ich habe nicht daran geglaubt, dass heute überhaupt noch Banken überfallen werden", wundert sich der Zeuge aus der Sparkasse. Renee D. drohen fünf Jahre Gefängnis, ein Jahr auf Bewährung, falls das Gericht den Fall als minderschwer einstuft und Therapie statt Knast verordnet. Am Donnerstag wird mit einem Urteil gerechnet."
sparkassenkunde - am Mittwoch, 5. Oktober 2005, 23:08 - Rubrik: Trachtenkunde des Bankraubs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Bereits vor geraumer Zeit wurde hier ("Aktenzeichen SMS ungelöst") über das SMS-Fahndungsprojekt von Schily berichtet.
Bereits im April 2004 berichtete Heise online, dass das Projekt in Bochum zu floppen droht. Nun kam das offizielle Eingeständnis, dass das mal wieder so eine TechnoPhantasie der Schily-Administration im Innenministerium gewesen ist:
SMS-Fahndung: Polizei stellt letztes Pilotprojekt ein
Als letzte von anfangs zwölf Dienststellen verzichtet das Bochumer Polizeipräsidium auf den weiteren Einsatz der SMS-Fahndung. Das mit zahlreichen Vorschusslorbeeren versehene Pilotprojekt war vom Bundeskriminalamt Ende 2002 ins Leben gerufen worden. Die Grundidee des Projekts bestand darin, das Instrumentarium der so genannten Öffentlichkeitsfahndung wie beispielsweise das Verteilen von Flugblättern bei Entführungsfällen um das populäre Medium SMS zu ergänzen. Diese wurden von der Polizei an ausgewählte Berufsgruppen wie Taxi- und Busfahrer oder Mitarbeiter des Ordnungsamts versandt -- in der Hoffnung, dass diese während ihrer normalen Arbeit Beobachtungen über vermisste Personen oder gesuchte Autos sammeln können. Am Bochumer Projekt wirkten über 700 Bürger mit, doch verhalfen deren Hinweise nicht ein einziges Mal dazu, einen Fall aufzuklären. Daher stand das Projekt nach gut zehn Monaten bereits Ende 2004 vor dem Aus.
Gegenüber heise online erklärte der Bochumer Projektleiter Frank Nows, dass das Ende des Versuchs keineswegs eine generelle Abkehr der Polizei vom Kommunikationsmedium SMS darstelle. So werde die für das Pilotprojekt geschaffene SMS-Applikation polizeiintern weitergenutzt, um während "Großlagen" Informationen per SMS auf die Handys ausgewählter Beamter zu senden. Dies habe sich zum Beispiel bei der Sicherung des Bundesparteitags der SPD bewährt, der im November 2003 in Bochum stattgefunden hatte.
Dass die öffentliche Fahndung per SMS in keinem der Pilotprojekte einen greifbaren Erfolg gebracht habe, führt Nows auch auf die geringe Anzahl der teilnehmenden Behörden zurück. Bei einem Preis von 7 Cent je Fahndungs-SMS seien die Kosten für dieses Fahndungsinstrument als günstig einzustufen -- demgegenüber koste der Einsatz eines Polizeihubschraubers je Flugstunde rund 1000 Euro. "Wenn eine Suche per Hubschrauber einmal erfolglos verläuft, wäre dies ein Grund, die Hubschrauberstaffeln der Polizei abzuschaffen?", gibt Nows zu bedenken. Mehr Erfolg als bei dem isolierten SMS-Projekt verspricht sich Nows von integrierten Fahndungsportalen, die die Büger sowohl per Internet-Zugang (stationär oder mobil) als auch über Mobilfunk-Dienste wie SMS oder MMS erreichen. (ssu/c't)
Vgl. a. Spiegel online (30.09.2005):
"Die Idee wird nicht weiter verfolgt"
"Es klang wie ein guter Plan: Per SMS, regte das Bundeskriminalamt an, könne man die Bevölkerung als Laien-Ermittler in Fahndungen einbinden. Am Ende einer zweijährigen, so gut wie erfolgsfreien Testphase verschwindet die "SMS-Fahndung" nun wieder in der Schublade.
Funkstille beim Innenministerium
Das Bundesinnenministerium in Berlin wollte am Freitag weder zu der Problematik noch zum Stand der Dinge Stellung nehmen. Angeblich hatte Innenminister Otto Schily das Projekt im Februar vergangenen Jahres befördert. Der SPD-Politiker habe sich davon eine schnellere Aufklärung von Straftaten und die rasche Ergreifung von Tätern versprochen. Als vorrangige Zielgruppe galten Taxifahrer, Bus- und Straßenbahnchauffeure sowie Mitarbeiter städtischer Ordnungsämter."
Bereits im April 2004 berichtete Heise online, dass das Projekt in Bochum zu floppen droht. Nun kam das offizielle Eingeständnis, dass das mal wieder so eine TechnoPhantasie der Schily-Administration im Innenministerium gewesen ist:
SMS-Fahndung: Polizei stellt letztes Pilotprojekt ein
Als letzte von anfangs zwölf Dienststellen verzichtet das Bochumer Polizeipräsidium auf den weiteren Einsatz der SMS-Fahndung. Das mit zahlreichen Vorschusslorbeeren versehene Pilotprojekt war vom Bundeskriminalamt Ende 2002 ins Leben gerufen worden. Die Grundidee des Projekts bestand darin, das Instrumentarium der so genannten Öffentlichkeitsfahndung wie beispielsweise das Verteilen von Flugblättern bei Entführungsfällen um das populäre Medium SMS zu ergänzen. Diese wurden von der Polizei an ausgewählte Berufsgruppen wie Taxi- und Busfahrer oder Mitarbeiter des Ordnungsamts versandt -- in der Hoffnung, dass diese während ihrer normalen Arbeit Beobachtungen über vermisste Personen oder gesuchte Autos sammeln können. Am Bochumer Projekt wirkten über 700 Bürger mit, doch verhalfen deren Hinweise nicht ein einziges Mal dazu, einen Fall aufzuklären. Daher stand das Projekt nach gut zehn Monaten bereits Ende 2004 vor dem Aus.
Gegenüber heise online erklärte der Bochumer Projektleiter Frank Nows, dass das Ende des Versuchs keineswegs eine generelle Abkehr der Polizei vom Kommunikationsmedium SMS darstelle. So werde die für das Pilotprojekt geschaffene SMS-Applikation polizeiintern weitergenutzt, um während "Großlagen" Informationen per SMS auf die Handys ausgewählter Beamter zu senden. Dies habe sich zum Beispiel bei der Sicherung des Bundesparteitags der SPD bewährt, der im November 2003 in Bochum stattgefunden hatte.
Dass die öffentliche Fahndung per SMS in keinem der Pilotprojekte einen greifbaren Erfolg gebracht habe, führt Nows auch auf die geringe Anzahl der teilnehmenden Behörden zurück. Bei einem Preis von 7 Cent je Fahndungs-SMS seien die Kosten für dieses Fahndungsinstrument als günstig einzustufen -- demgegenüber koste der Einsatz eines Polizeihubschraubers je Flugstunde rund 1000 Euro. "Wenn eine Suche per Hubschrauber einmal erfolglos verläuft, wäre dies ein Grund, die Hubschrauberstaffeln der Polizei abzuschaffen?", gibt Nows zu bedenken. Mehr Erfolg als bei dem isolierten SMS-Projekt verspricht sich Nows von integrierten Fahndungsportalen, die die Büger sowohl per Internet-Zugang (stationär oder mobil) als auch über Mobilfunk-Dienste wie SMS oder MMS erreichen. (ssu/c't)
Vgl. a. Spiegel online (30.09.2005):
"Die Idee wird nicht weiter verfolgt"
"Es klang wie ein guter Plan: Per SMS, regte das Bundeskriminalamt an, könne man die Bevölkerung als Laien-Ermittler in Fahndungen einbinden. Am Ende einer zweijährigen, so gut wie erfolgsfreien Testphase verschwindet die "SMS-Fahndung" nun wieder in der Schublade.
Funkstille beim Innenministerium
Das Bundesinnenministerium in Berlin wollte am Freitag weder zu der Problematik noch zum Stand der Dinge Stellung nehmen. Angeblich hatte Innenminister Otto Schily das Projekt im Februar vergangenen Jahres befördert. Der SPD-Politiker habe sich davon eine schnellere Aufklärung von Straftaten und die rasche Ergreifung von Tätern versprochen. Als vorrangige Zielgruppe galten Taxifahrer, Bus- und Straßenbahnchauffeure sowie Mitarbeiter städtischer Ordnungsämter."
contributor - am Dienstag, 4. Oktober 2005, 21:33 - Rubrik: Techniken der Fahndung und Ueberwachung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf den Webseiten des italienischen "coolclubs" ("Un gruppo di amici, quello della Coolcub, che intende fare del Salento un polo di risonanza nazionale, e non solo, per tutto quello che concerne il pianeta musica") findet sich folgende Besprechung (15.9. 2003) der italienischen Version von "Vabanque"):
La rapina in banca
a cura di Klaus Schönberger
DeriveApprodi 2003
I soldi? Chiedili alla tua banca. Confessate, chi di voi almeno una volta nella vita non ha sognato viaggi nei Caraibi, ville da sogno su spiagge incontaminate, corse mozzafiato a bordo di Ferrari rosse fiammanti, feste dove corrono fiumi e fiumi di champagne francese. E tutto questo finanziato, confessatelo coraggio, ci avete pensato, grazie ad una semplice, poco faticosa anche se leggermente rischiosa forse, piccola, rapida ed efficace azione: una rapina in banca. Neanche se siete un prete o un poliziotto credo che il vostro disappunto in questo momento sia reale e sincero. La rapina in banca da sempre esercita un fascino e una simpatia tutta particolare. È l'unico crimine che non incontra la condanna della società civile. Raramente si riesce a scandalizzarsi di fronte ad un colpo andato a buon fine, senza spargimento di sangue innocente, magari svoltosi in circostanze stravaganti ed originali, magari con un bottino straordinario, magari ai danni di una banca particolarmente grossa e chiacchierata. Sono tanti i motivi che spigano questa innata simpatia del rapinatore di banche e sono tanti i rapinatori che ci hanno fatto sognare, provare invidia e magari innamorare. Chi non ha sognato di essere il Clyde di fianco alla bella Bonnie o viceversa? Quale donna non ha segretamente sognato di incontrare un ladro gentiluomo come Renè Vallanzasca o Horst Fantazzini? E quanti scrittori e cineasti hanno costruito le loro storie fortunate attorno al personaggio di un bel ladro tenebroso e spericolato?
Comunque, per chi voglia saperne di più della rapina in banca, della sua storia, per chi voglia conoscere alcune teorie intorno al crimine più diffuso del mondo, e perché no, per chi voglia apprendere qualche consiglio pratico, è in commercio un simpatico e dettagliatissimo libro edito dalla piccola e militante casa editrice romana DeriveApprodi. Il libro, curato dall'eccentrico professore tedesco Klaus Schönberger è un vero e proprio compendio sulla rapina in banca. Contiene biografie dei principali protagonisti a partire dai primi assalti ai treni portavalori nell'America
del selvaggio west, saggi sociologici ed economici sulle cause, gli effetti e la percezione del reato,ed alcuni racconti in prima persona di rapinatori più o meno famosi.
È una lettura piacevole, un testo accattivante e profondo, che lascia spazio anche al desiderio di rompere con questa società e darsi alla
rapina. E chissà che fra i lettori di questo libro non si nasconda un nuovo Arsenio Lupin. O, meglio ancora e perché no, un nuovo Robin Hood.
Auf "Anzt" (AnarchistNewsService) lesen wir gleichermaßen eine kurze Besprechung:
"La rapina in banca è senza dubbio il crimine più socialmente invidiato. I rapinatori sono, infatti, i criminali più amati e che riscuotono la maggiore simpatia dell'opinione pubblica. Da sempre. Iniziata nell'Europa mercantile, ma diffusasi solo nel selvaggio West americano, la rapina in banca ha una storia lunga e molti protagonisti. Da Bonnie & Clyde a Horst Fantazzini, dalle bank ladies ai Tupamaros, gli innumerevoli furti ai depositi di denaro dimostrano che i soldi piacciono a tutti. In questo libro si troveranno casseforti ripulite, diligenze assaltate, banche svaligiate, furgoni portavalori distrutti. Professionisti del furto con scasso dall'impeccabile fair play e anziane signore che vogliono arrotondare la pensione. Sistemi di sicurezza e allarmi, vie di fuga e nascondigli. Più che la storia di un crimine, La rapina in banca coincide con la storia di un sogno: diventare ricchi senza fatica."
La rapina in banca
a cura di Klaus Schönberger
DeriveApprodi 2003
I soldi? Chiedili alla tua banca. Confessate, chi di voi almeno una volta nella vita non ha sognato viaggi nei Caraibi, ville da sogno su spiagge incontaminate, corse mozzafiato a bordo di Ferrari rosse fiammanti, feste dove corrono fiumi e fiumi di champagne francese. E tutto questo finanziato, confessatelo coraggio, ci avete pensato, grazie ad una semplice, poco faticosa anche se leggermente rischiosa forse, piccola, rapida ed efficace azione: una rapina in banca. Neanche se siete un prete o un poliziotto credo che il vostro disappunto in questo momento sia reale e sincero. La rapina in banca da sempre esercita un fascino e una simpatia tutta particolare. È l'unico crimine che non incontra la condanna della società civile. Raramente si riesce a scandalizzarsi di fronte ad un colpo andato a buon fine, senza spargimento di sangue innocente, magari svoltosi in circostanze stravaganti ed originali, magari con un bottino straordinario, magari ai danni di una banca particolarmente grossa e chiacchierata. Sono tanti i motivi che spigano questa innata simpatia del rapinatore di banche e sono tanti i rapinatori che ci hanno fatto sognare, provare invidia e magari innamorare. Chi non ha sognato di essere il Clyde di fianco alla bella Bonnie o viceversa? Quale donna non ha segretamente sognato di incontrare un ladro gentiluomo come Renè Vallanzasca o Horst Fantazzini? E quanti scrittori e cineasti hanno costruito le loro storie fortunate attorno al personaggio di un bel ladro tenebroso e spericolato?
Comunque, per chi voglia saperne di più della rapina in banca, della sua storia, per chi voglia conoscere alcune teorie intorno al crimine più diffuso del mondo, e perché no, per chi voglia apprendere qualche consiglio pratico, è in commercio un simpatico e dettagliatissimo libro edito dalla piccola e militante casa editrice romana DeriveApprodi. Il libro, curato dall'eccentrico professore tedesco Klaus Schönberger è un vero e proprio compendio sulla rapina in banca. Contiene biografie dei principali protagonisti a partire dai primi assalti ai treni portavalori nell'America
del selvaggio west, saggi sociologici ed economici sulle cause, gli effetti e la percezione del reato,ed alcuni racconti in prima persona di rapinatori più o meno famosi.
È una lettura piacevole, un testo accattivante e profondo, che lascia spazio anche al desiderio di rompere con questa società e darsi alla
rapina. E chissà che fra i lettori di questo libro non si nasconda un nuovo Arsenio Lupin. O, meglio ancora e perché no, un nuovo Robin Hood.
Auf "Anzt" (AnarchistNewsService) lesen wir gleichermaßen eine kurze Besprechung:
"La rapina in banca è senza dubbio il crimine più socialmente invidiato. I rapinatori sono, infatti, i criminali più amati e che riscuotono la maggiore simpatia dell'opinione pubblica. Da sempre. Iniziata nell'Europa mercantile, ma diffusasi solo nel selvaggio West americano, la rapina in banca ha una storia lunga e molti protagonisti. Da Bonnie & Clyde a Horst Fantazzini, dalle bank ladies ai Tupamaros, gli innumerevoli furti ai depositi di denaro dimostrano che i soldi piacciono a tutti. In questo libro si troveranno casseforti ripulite, diligenze assaltate, banche svaligiate, furgoni portavalori distrutti. Professionisti del furto con scasso dall'impeccabile fair play e anziane signore che vogliono arrotondare la pensione. Sistemi di sicurezza e allarmi, vie di fuga e nascondigli. Più che la storia di un crimine, La rapina in banca coincide con la storia di un sogno: diventare ricchi senza fatica."
vabanque - am Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:31 - Rubrik: La Rapina in Banca (versione italiana)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Hier folgen Auszüge aus einer Besprechung eines Buches der Autoren (Emilio Quadrelli) der italienischen Ausgabe von "Vabanque":
Alessandro Dal Lago – Emilio Quadrelli, "La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini", Feltrinelli, 2003, pp. 402, € 20,00
Frutto di un lavoro durato cinque anni (1997-2002), durante i quali sono state intervistate circa quattrocento persone (in larga maggioranza ladri, rapinatori, spacciatori e consumatori di droghe, prostituti/e italiani/e e stranieri/e e i loro clienti, usurai, intermediatori di “affari”, giocatori d’azzardo, ma anche commercianti, gestori di locali pubblici, imprenditori, operatori sociali, membri delle forze di polizia, magistrati) di duecento delle quali il volume accoglie le testimonianze, la ricerca etnografica condotta da Dal Lago e Quadrelli, docenti presso l’Università di Genova, ha avuto come epicentro il capoluogo ligure, ma i risultati ai quali perviene assumono una valenza più generale, potendosi Genova considerare come una città-laboratorio, in quanto anche qui, come nel resto d’Italia, si sono avuti quei mutamenti nella struttura dell’economia, nelle forme di organizzazione e di autorappresentazione di ciò che resta della classe operaia, nelle modalità di gestione ed amministrazione del potere locale, nella gestione dei flussi migratori e della disoccupazione giovanile che si è soliti individuare come elementi caratterizzanti la società postindustriale.
Resi espliciti nell’ampia introduzione i problemi incontrati e i criteri adottati per «narrare l’infamia», il libro si articola in otto capitoli (più un epilogo), ciascuno dei quali ricostruisce con abbondanza di dati e acume interpretativo i protagonisti, i servizi offerti, l’ampiezza, le caratteristiche e l’evoluzione della clientela, le dinamiche interne, il sistema di relazioni instaurate con il mondo legale e l’evoluzione conosciuta nel corso degli anni, di uno specifico «mercato illegale»: i piccoli traffici ai quali da sempre si dedica la malavita tradizionale radicata nei quartieri del centro antico; le «batterie» di rapinatori che nei primi anni Settanta, a Genova come nelle altre aree metropolitane del triangolo industriale, avevano dato vita a forme inedite di criminalità (1) ; il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine; l’usura; lo sfruttamento economico degli immigrati clandestini; la prostituzione femminile e quella maschile; le droghe. Completano il volume una quarantina di pagine di note e altre venti di utilissimi e aggiornati riferimenti bibliografici.
Lo scopo della ricerca, come viene esplicitato fin dalle prime pagine del libro, è quello di indagare i rapporti esistenti tra due «mondi» che, pur condividendo i medesimi spazi, appaiono a tutta prima connotati da una radicale alterità: quello “visibile” dei «cittadini» e quello “sotterraneo” dei «criminali». L’ipotesi interpretativa da cui gli autori partono, e che trova conferma al termine del loro lavoro, è invece quella di «una clamorosa discrepanza tra la realtà del crimine […] e la sua rappresentazione prevalente» nei media così come presso le istituzioni e le scienze specialistiche, abituati a considerare il crimine come un affare esclusivo dell’«ombra», del sottosuolo, qualcosa di radicalmente eterogeneo rispetto al mondo della “normalità” e della società legittima, costantemente minacciata, quest’ultima, dal mondo delle tenebre.
(... )
Al termine della loro ricerca, gli autori possono quindi riprendere e meglio precisare l’ipotesi di lavoro da cui erano partiti: «I mercati illegali sono solo in parte di competenza dei criminali. In una misura che varia a seconda dei tipi di mercato, i cittadini accedono ai mercati illegali sfruttando le possibilità che questi offrono. Ma la definizione sociale o stigmatizzazione del crimine li riguarda solo marginalmente. Saranno soprattutto figure “specializzate” passivamente (etichettate a priori) a giocare il ruolo di parte per il tutto e a rappresentare quindi, per l’opinione pubblica e le istituzioni, i mercati illegali e i mondi criminali. Tale rappresentazione sociale contribuisce a modellare l’azione delle istituzioni nei confronti dei mercati illegali e a definirne ambito e dimensioni».
(...)
(1) Per un approfondimento di questo finora poco indagato segmento della storia criminale del nostro paese si veda il contributo di E. Quadrelli nel volume a cura di Klaus Schönberger, La rapina in banca. Storia. Teoria. Pratica, DeriveApprodi 2003, e soprattutto, dello stesso Quadrelli, Andare ai resti. Banditi, rapinatori, guerriglieri nell’Italia degli anni Settanta, DeriveApprodi 2004)
Alessandro Dal Lago – Emilio Quadrelli, "La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini", Feltrinelli, 2003, pp. 402, € 20,00
Frutto di un lavoro durato cinque anni (1997-2002), durante i quali sono state intervistate circa quattrocento persone (in larga maggioranza ladri, rapinatori, spacciatori e consumatori di droghe, prostituti/e italiani/e e stranieri/e e i loro clienti, usurai, intermediatori di “affari”, giocatori d’azzardo, ma anche commercianti, gestori di locali pubblici, imprenditori, operatori sociali, membri delle forze di polizia, magistrati) di duecento delle quali il volume accoglie le testimonianze, la ricerca etnografica condotta da Dal Lago e Quadrelli, docenti presso l’Università di Genova, ha avuto come epicentro il capoluogo ligure, ma i risultati ai quali perviene assumono una valenza più generale, potendosi Genova considerare come una città-laboratorio, in quanto anche qui, come nel resto d’Italia, si sono avuti quei mutamenti nella struttura dell’economia, nelle forme di organizzazione e di autorappresentazione di ciò che resta della classe operaia, nelle modalità di gestione ed amministrazione del potere locale, nella gestione dei flussi migratori e della disoccupazione giovanile che si è soliti individuare come elementi caratterizzanti la società postindustriale.
Resi espliciti nell’ampia introduzione i problemi incontrati e i criteri adottati per «narrare l’infamia», il libro si articola in otto capitoli (più un epilogo), ciascuno dei quali ricostruisce con abbondanza di dati e acume interpretativo i protagonisti, i servizi offerti, l’ampiezza, le caratteristiche e l’evoluzione della clientela, le dinamiche interne, il sistema di relazioni instaurate con il mondo legale e l’evoluzione conosciuta nel corso degli anni, di uno specifico «mercato illegale»: i piccoli traffici ai quali da sempre si dedica la malavita tradizionale radicata nei quartieri del centro antico; le «batterie» di rapinatori che nei primi anni Settanta, a Genova come nelle altre aree metropolitane del triangolo industriale, avevano dato vita a forme inedite di criminalità (1) ; il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine; l’usura; lo sfruttamento economico degli immigrati clandestini; la prostituzione femminile e quella maschile; le droghe. Completano il volume una quarantina di pagine di note e altre venti di utilissimi e aggiornati riferimenti bibliografici.
Lo scopo della ricerca, come viene esplicitato fin dalle prime pagine del libro, è quello di indagare i rapporti esistenti tra due «mondi» che, pur condividendo i medesimi spazi, appaiono a tutta prima connotati da una radicale alterità: quello “visibile” dei «cittadini» e quello “sotterraneo” dei «criminali». L’ipotesi interpretativa da cui gli autori partono, e che trova conferma al termine del loro lavoro, è invece quella di «una clamorosa discrepanza tra la realtà del crimine […] e la sua rappresentazione prevalente» nei media così come presso le istituzioni e le scienze specialistiche, abituati a considerare il crimine come un affare esclusivo dell’«ombra», del sottosuolo, qualcosa di radicalmente eterogeneo rispetto al mondo della “normalità” e della società legittima, costantemente minacciata, quest’ultima, dal mondo delle tenebre.
(... )
Al termine della loro ricerca, gli autori possono quindi riprendere e meglio precisare l’ipotesi di lavoro da cui erano partiti: «I mercati illegali sono solo in parte di competenza dei criminali. In una misura che varia a seconda dei tipi di mercato, i cittadini accedono ai mercati illegali sfruttando le possibilità che questi offrono. Ma la definizione sociale o stigmatizzazione del crimine li riguarda solo marginalmente. Saranno soprattutto figure “specializzate” passivamente (etichettate a priori) a giocare il ruolo di parte per il tutto e a rappresentare quindi, per l’opinione pubblica e le istituzioni, i mercati illegali e i mondi criminali. Tale rappresentazione sociale contribuisce a modellare l’azione delle istituzioni nei confronti dei mercati illegali e a definirne ambito e dimensioni».
(...)
(1) Per un approfondimento di questo finora poco indagato segmento della storia criminale del nostro paese si veda il contributo di E. Quadrelli nel volume a cura di Klaus Schönberger, La rapina in banca. Storia. Teoria. Pratica, DeriveApprodi 2003, e soprattutto, dello stesso Quadrelli, Andare ai resti. Banditi, rapinatori, guerriglieri nell’Italia degli anni Settanta, DeriveApprodi 2004)
vabanque - am Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:13 - Rubrik: La Rapina in Banca (versione italiana)
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Wir sehen unsere Kunden immer weniger. Nur die Bankräuber kommen immer öfter" meint Peter Püspök, Chef der Raiffeisenlandesbank im Kurier (3.10. 2005)
Beratung statt voller Kassenhallen
"Schlechte Geschäftszeiten, oft wechselnde Betreuer und hohe Spesen: Das sind meist jene Punkte, über die sich Bankkunden ärgern. "80 bis 90 Prozent aller Kunden werden nicht optimal betreut", meint Peter Püspök, Chef der Raiffeisenlandesbank (RLB) NÖ-Wien. Viele seien unterinformiert. Andere wiederum könnten aus dem Überangebot an Informationen die für sie richtigen nicht herausfiltern.
Die RLB NÖ-Wien hat daher bereits vor geraumer Zeit ihr Beratungsservice ausgebaut und bestehende Filialen dahingehend umgebaut. "Vier dieser Beratungsbüros gibt es in Wien bereits, heuer folgen drei weitere", kündigt Püspök an. Denn der Trend hin zu prall gefüllten Beraterbüros, aber leeren Schalterhallen gehe weiter. "Nur die Bankräuber, die mehrheitlich in die Kategorie Auslandsgeschäft einzureihen sind, kommen immer öfter", ätzt Püspök. Einziges Problem der Strategie sei, Mitarbeiter schnell und effizient auszubilden: "Das ist der Flaschenhals."
Dann folgt noch ein bisschen Public Relations, was hier ja nicht von Belang ist ...
Beratung statt voller Kassenhallen
"Schlechte Geschäftszeiten, oft wechselnde Betreuer und hohe Spesen: Das sind meist jene Punkte, über die sich Bankkunden ärgern. "80 bis 90 Prozent aller Kunden werden nicht optimal betreut", meint Peter Püspök, Chef der Raiffeisenlandesbank (RLB) NÖ-Wien. Viele seien unterinformiert. Andere wiederum könnten aus dem Überangebot an Informationen die für sie richtigen nicht herausfiltern.
Die RLB NÖ-Wien hat daher bereits vor geraumer Zeit ihr Beratungsservice ausgebaut und bestehende Filialen dahingehend umgebaut. "Vier dieser Beratungsbüros gibt es in Wien bereits, heuer folgen drei weitere", kündigt Püspök an. Denn der Trend hin zu prall gefüllten Beraterbüros, aber leeren Schalterhallen gehe weiter. "Nur die Bankräuber, die mehrheitlich in die Kategorie Auslandsgeschäft einzureihen sind, kommen immer öfter", ätzt Püspök. Einziges Problem der Strategie sei, Mitarbeiter schnell und effizient auszubilden: "Das ist der Flaschenhals."
Dann folgt noch ein bisschen Public Relations, was hier ja nicht von Belang ist ...
vabanque - am Dienstag, 4. Oktober 2005, 14:30 - Rubrik: Ueber Banken
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Über die hohen Haftstrafen für bankräubernde Anarchisten wurde hier bereits berichtet.
Auch über die Berichterstattung des nrw-taz-Journalisten Michael Klarmann, der nunmehr in einem wohl abschließenden Artikel ("Links: Ende des Kasperletheaters und der Kindereien in der Imbissbude des Aachener Landgerichtes, taz. 28.9. 2005) erneut die ganzen Absonderlichkeiten des Verfahrens und insbesondere das Verhalten der SymphatisantInnen der Angeklagten nochmals Revue passieren lassen darf. Klarmann suggeriert über die Gewichtung den Anschein, als stünden eigentlich die UnterstützerInnen der Angeklagten vor Gericht. Zumindest moralisch.
Der Klarmann-Artikel verströmt zudem den Geschmack einer post-autonomen Zeit, die es offenbar erstaunlicher findet, dass es hierzulande noch Leute gibt, die eine gewiss aussichtslose Position vertreten, sich aber von nichts davon abbringen lassen, weil sie ihre Interessen artikulieren. Die Reaktion der Medien lautet "Infantilisierung".
Nun ja, die Autonomen dürfen sich nicht wundern, wenn derlei "symbolische Politiken", die tagtäglich vom Mainstream inszeniert werden, gerade bei ihnen gefahrlos kritisiert werden können. Das Problem damit ist nur, dass der Übergang von der vermeintlichen neutralen Schilderung zur impliziten Forderung nach Kriminalisierung ziemlich fließend ist.
Aber nochmals auf die dahinter stehende Haltung zurückzukommen. Der Hass auf die Linkspartei im Wahlkampf wurde aus ganz ähnlichen Quellen gespeist: Dieses Pack wagt sich doch tatsächlich immer noch zu Wort zu melden. Nur mit dem Unterschied, dass die Autonomen nicht nur quantitativ marginalisiert sind, sondern inzwischen auch symbolisch ziemlich schlecht dastehen. Aber das müssen sie unter sich ausmachen. Vor den Klarmännern dieser taz-Welt nehmen wir sie aber allemal in Schutz.
Auch über die Berichterstattung des nrw-taz-Journalisten Michael Klarmann, der nunmehr in einem wohl abschließenden Artikel ("Links: Ende des Kasperletheaters und der Kindereien in der Imbissbude des Aachener Landgerichtes, taz. 28.9. 2005) erneut die ganzen Absonderlichkeiten des Verfahrens und insbesondere das Verhalten der SymphatisantInnen der Angeklagten nochmals Revue passieren lassen darf. Klarmann suggeriert über die Gewichtung den Anschein, als stünden eigentlich die UnterstützerInnen der Angeklagten vor Gericht. Zumindest moralisch.
Der Klarmann-Artikel verströmt zudem den Geschmack einer post-autonomen Zeit, die es offenbar erstaunlicher findet, dass es hierzulande noch Leute gibt, die eine gewiss aussichtslose Position vertreten, sich aber von nichts davon abbringen lassen, weil sie ihre Interessen artikulieren. Die Reaktion der Medien lautet "Infantilisierung".
Nun ja, die Autonomen dürfen sich nicht wundern, wenn derlei "symbolische Politiken", die tagtäglich vom Mainstream inszeniert werden, gerade bei ihnen gefahrlos kritisiert werden können. Das Problem damit ist nur, dass der Übergang von der vermeintlichen neutralen Schilderung zur impliziten Forderung nach Kriminalisierung ziemlich fließend ist.
Aber nochmals auf die dahinter stehende Haltung zurückzukommen. Der Hass auf die Linkspartei im Wahlkampf wurde aus ganz ähnlichen Quellen gespeist: Dieses Pack wagt sich doch tatsächlich immer noch zu Wort zu melden. Nur mit dem Unterschied, dass die Autonomen nicht nur quantitativ marginalisiert sind, sondern inzwischen auch symbolisch ziemlich schlecht dastehen. Aber das müssen sie unter sich ausmachen. Vor den Klarmännern dieser taz-Welt nehmen wir sie aber allemal in Schutz.
vabanque - am Montag, 3. Oktober 2005, 15:08 - Rubrik: Politischer Bankraub
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Überall wird es berichtet, so natürlich auch in der Kronen-Zeitung (30.9. 2005). Ein Teil der Beute aus dem Millionencoups von Brasilien wurde sichergestellt sowie Verdächtige offensichtlich verhaftet.
contributor - am Samstag, 1. Oktober 2005, 22:53 - Rubrik: Millionencoup
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Der Handelsblatt-Korrespondent für Südamerika, Alexander Busch, (3.9. 2005) weiss, was die BrasilianerInnen für ehrliche Arbeit halten:
Bankraub - war das was?
"Knapp drei Wochen ist es her, da stahlen Bankräuber umgerechnet rund 63 Millionen Euro in gebrauchten, nicht nummerierten Banknoten aus dem Tresor der Zentralbank in Fortaleza, einer Provinzhauptstadt im Norden Brasiliens. Es war einer der größten Bankplünderungen der Geschichte weltweit. Die gesamte internationale Presse berichtete ausführlich darüber. Doch in Brasilien selbst war der Millionen-Raub nach zwei Tagen aus den Schlagzeilen verschwunden. Es wurden zwar noch ein paar hunderttausend Banknoten in Kofferräumen von Autos entdeckt, die in Sattelschleppern auf den Weg zu den Metropolen nach Süden waren. Auch ein Teenager wurde dabei ertappt, wie er in einer Shopping-Mall der Hauptstadt Brasilias mit noch original verpackten Banknotenbündeln einkaufen wollte. Doch ansonsten ist der Raub vergessen. Niemand scheint sich noch dafür zu interessieren, was mit den dreieinhalb Tonnen Banknoten geschehen ist. In der Presseabteilung der Zentralbank muss man ausführlich sein Anliegen erklären, damit der Sachbearbeiter sich überhaupt an den Vorfall erinnert. Mein Verdacht: Bei der anhaltenden Korruption in Brasiliens Politik, wo schwarze Kassen zur Parteinfinanzierung und Stimmenkauf in Höhe von 150 Millionen Euro existiert haben sollen - da interessiert sich die Öffentlichkeit einfach nicht für einen Bankraub, bei dem vergleichsweise "ehrlich" gearbeitet wurde: Immerhin eröffneten die rund ein Dutzend Räuber zur Fassade einen Gartenbaubetrieb, gruben drei Monate lang einen Tunnel bis zum Tresor der Zentralbank und nutzten dann ein Wochenende, um unbemerkt in den Safe einzudringen und in stundenlanger Schlepperei durch die klimatisierte Grube die Banknoten weg zu schaffen - eine organisatorische und logistische Meisterleistung, der die meisten Brasilianer Respekt zollen. Ganz anders als den schmierigen Geldwäschern und Politikern."
Über ihn heisst es:
"Alexander Busch, 41, ist seit zwölf Jahren in Brasilien als Korrespondent für Südamerika mit Sitz in São Paulo tätig. Im Privatleben interessiert er sich für Jazz, Latino-Musik und gute Küche."
Und Bankraub?
Bankraub - war das was?
"Knapp drei Wochen ist es her, da stahlen Bankräuber umgerechnet rund 63 Millionen Euro in gebrauchten, nicht nummerierten Banknoten aus dem Tresor der Zentralbank in Fortaleza, einer Provinzhauptstadt im Norden Brasiliens. Es war einer der größten Bankplünderungen der Geschichte weltweit. Die gesamte internationale Presse berichtete ausführlich darüber. Doch in Brasilien selbst war der Millionen-Raub nach zwei Tagen aus den Schlagzeilen verschwunden. Es wurden zwar noch ein paar hunderttausend Banknoten in Kofferräumen von Autos entdeckt, die in Sattelschleppern auf den Weg zu den Metropolen nach Süden waren. Auch ein Teenager wurde dabei ertappt, wie er in einer Shopping-Mall der Hauptstadt Brasilias mit noch original verpackten Banknotenbündeln einkaufen wollte. Doch ansonsten ist der Raub vergessen. Niemand scheint sich noch dafür zu interessieren, was mit den dreieinhalb Tonnen Banknoten geschehen ist. In der Presseabteilung der Zentralbank muss man ausführlich sein Anliegen erklären, damit der Sachbearbeiter sich überhaupt an den Vorfall erinnert. Mein Verdacht: Bei der anhaltenden Korruption in Brasiliens Politik, wo schwarze Kassen zur Parteinfinanzierung und Stimmenkauf in Höhe von 150 Millionen Euro existiert haben sollen - da interessiert sich die Öffentlichkeit einfach nicht für einen Bankraub, bei dem vergleichsweise "ehrlich" gearbeitet wurde: Immerhin eröffneten die rund ein Dutzend Räuber zur Fassade einen Gartenbaubetrieb, gruben drei Monate lang einen Tunnel bis zum Tresor der Zentralbank und nutzten dann ein Wochenende, um unbemerkt in den Safe einzudringen und in stundenlanger Schlepperei durch die klimatisierte Grube die Banknoten weg zu schaffen - eine organisatorische und logistische Meisterleistung, der die meisten Brasilianer Respekt zollen. Ganz anders als den schmierigen Geldwäschern und Politikern."
Über ihn heisst es:
"Alexander Busch, 41, ist seit zwölf Jahren in Brasilien als Korrespondent für Südamerika mit Sitz in São Paulo tätig. Im Privatleben interessiert er sich für Jazz, Latino-Musik und gute Küche."
Und Bankraub?
vabanque - am Donnerstag, 29. September 2005, 19:03 - Rubrik: Millionencoup
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Vor kurzem lief dieser Film im Bayrischen Fernsehen - nun auf
ARTE - 29.09.2005 20:40 Uhr
Wiederholung: 02.10.2005 um 00:45
Die Letzten beißen die Hunde
Spielfilm, USA 1974, ARD
Der Bankräuber John "Thunderbolt" Doherty (Clint Eastwood) hat die alte Schule wieder gefunden, in der eine halbe Million Dollar Beute versteckt liegt.
Clint Eastwood, der im Mai 75 Jahre alt wurde, ist längst eine Legende. Michael Cimino arbeitete als Drehbuchautor und Dokumentarfilmer, bevor er von Eastwood als Newcomer die Chance bekam, das Buddy-Movie "Die Letzten beißen die Hunde" (1974) zu realisieren. Es war die Neubelebung eines ganzen Genres.
Der Ganove John "Thunderbolt" Doherty (Clint Eastwood) befindet sich in Priesterkleidern auf der Flucht vor seinen früheren Komplizen Goody (Geoffrey Lewis) und Red (George Kennedy), die hinter ihm her sind, weil sie glauben, er habe eine halbe Million Dollar aus einem gemeinsamen Bankraub verschwinden lassen, ohne mit ihnen zu teilen.
Als Thunderbolt bei einer Schießerei in einem kleinen Ort in Idaho von dem jungen Herumtreiber Lightfoot (Jeff Bridges) gerettet wird, der ihn in sein gerade gestohlenes Auto zerrt, beginnt eine seltsame Freundschaft. Die vermeintlich "betrogenen" Komplizen - Thunderbolt hatte die Beute in einer inzwischen abgerissenen Schule versteckt - kann er schließlich doch noch davon überzeugen, dass er das Verschwinden der Beute nicht verschuldet hat. Trotz der gefährlich unterschiedlichen Temperamente entschließt sich die neue Gang schließlich dazu, in erweiterter Besetzung die Bank noch einmal zu überfallen.
Doch leider misslingt dieser Coup. Von der Polizei gejagt, können nur Thunderbolt und Lightfoot entkommen. Aber auch für Lightfoot endet die Geschichte schließlich lethal.
Detaillierte Infos
ARTE - 29.09.2005 20:40 Uhr
Wiederholung: 02.10.2005 um 00:45
Die Letzten beißen die Hunde
Spielfilm, USA 1974, ARD
Der Bankräuber John "Thunderbolt" Doherty (Clint Eastwood) hat die alte Schule wieder gefunden, in der eine halbe Million Dollar Beute versteckt liegt.
Clint Eastwood, der im Mai 75 Jahre alt wurde, ist längst eine Legende. Michael Cimino arbeitete als Drehbuchautor und Dokumentarfilmer, bevor er von Eastwood als Newcomer die Chance bekam, das Buddy-Movie "Die Letzten beißen die Hunde" (1974) zu realisieren. Es war die Neubelebung eines ganzen Genres.
Der Ganove John "Thunderbolt" Doherty (Clint Eastwood) befindet sich in Priesterkleidern auf der Flucht vor seinen früheren Komplizen Goody (Geoffrey Lewis) und Red (George Kennedy), die hinter ihm her sind, weil sie glauben, er habe eine halbe Million Dollar aus einem gemeinsamen Bankraub verschwinden lassen, ohne mit ihnen zu teilen.
Als Thunderbolt bei einer Schießerei in einem kleinen Ort in Idaho von dem jungen Herumtreiber Lightfoot (Jeff Bridges) gerettet wird, der ihn in sein gerade gestohlenes Auto zerrt, beginnt eine seltsame Freundschaft. Die vermeintlich "betrogenen" Komplizen - Thunderbolt hatte die Beute in einer inzwischen abgerissenen Schule versteckt - kann er schließlich doch noch davon überzeugen, dass er das Verschwinden der Beute nicht verschuldet hat. Trotz der gefährlich unterschiedlichen Temperamente entschließt sich die neue Gang schließlich dazu, in erweiterter Besetzung die Bank noch einmal zu überfallen.
Doch leider misslingt dieser Coup. Von der Polizei gejagt, können nur Thunderbolt und Lightfoot entkommen. Aber auch für Lightfoot endet die Geschichte schließlich lethal.
Detaillierte Infos
contributor - am Donnerstag, 29. September 2005, 17:59 - Rubrik: Bankraub in Film und Fernsehen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Drei Geiselnehmer aus der belgischen und spanischen Anarchisten-Szene sind am Mittwoch in Aachen zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer hatten im Juni 2004 bei einer Polizeikontrolle in Aachen ein Ehepaar als Geisel genommen und waren geflüchtet. Die beiden 45- und 37-jährigen Hauptangeklagten wurden zu 14 und 13 Jahren Haft verurteilt. Ein 26-jähriger Belgier muss drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.
Während der Richter das Urteil verlas, übertönten ihn Sympathisanten der Angeklagten im Zuschauerraum mit spanischen Revolutionsliedern. Der Richter verwies sie des Saales. Bei ihrer Flucht hatten die Angeklagten mehrfach auf Polizisten geschossen. Die Anklage lautete auf versuchten Mord und Geiselnahme. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu 15 Jahren Haft gefordert. Eine mitangeklagte Frau wurde der Beihilfe zum Bankraub beschuldigt.
(29.9. 2005)
Während der Richter das Urteil verlas, übertönten ihn Sympathisanten der Angeklagten im Zuschauerraum mit spanischen Revolutionsliedern. Der Richter verwies sie des Saales. Bei ihrer Flucht hatten die Angeklagten mehrfach auf Polizisten geschossen. Die Anklage lautete auf versuchten Mord und Geiselnahme. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu 15 Jahren Haft gefordert. Eine mitangeklagte Frau wurde der Beihilfe zum Bankraub beschuldigt.
(29.9. 2005)
contributor - am Donnerstag, 29. September 2005, 17:53 - Rubrik: Politischer Bankraub
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Es hat ein wenig gedauert, bis ich es im Netz gefunden habe, das schöne alte Georg-Kreisler-Lied "Mütterlein". Aber gestern war ich auf einem Fest und dort spielte es jemand in einer Gitarren-Version. Somit war es nicht mehr schwierig zu finden. Das Stück stammte ursprünglich von "Unheilbar Gesund" (1964); bekannt wurde es über die legendären "Everblacks"-Platte von 1972.
Selbstverständlich berührt es Georg Kreisler, wenn eine Mutter einen solch getreuen Sohn hat, der aus Rache für das geschnappte Mütterlein, die Länderbank nun selbst knacken will ...
Anhören kann man sich dieses für den Kreislerschen Schwarzen Humor typische Chanson hier
Mütterlein
Ich sitz oft zu Hause, wenn Dämmerung beginnt,
doch zünd ich die Lampe nicht an.
Ich denke der Jahre, die hinter mir sind,
und frage mich ehrlich sodann:
Wem soll ich für das, was ich bin, dankbar sein?
Der Schule? Dem Zufall? Dem Glück?
Nein, mein Dank, der gebührt einer Frau ganz allein,
und an sie denk ich immer zurück:
Mütterlein, Mütterlein,
du warst mehr als Gold und Geld.
Man kann beinah sagen, ohne dich
wär' ich heut nicht auf der Welt.
Mütterlein, Mütterlein,
oh, wie gut warst du zu mir!
Pokerspielen und Motorradfahren,
all das kann ich nur von dir.
Als ich tat die erste Bitte,
hast du sie mir abgeschlagen.
Als ich tat die ersten Schritte,
hast du mich zum Fluß getragen.
Nie ließt du mir etwas fehlen.
Nein, es war dein stiller Brauch,
was benötigt wird, zu stehlen.
Was man nicht benötigt auch.
Als ich bei Herrn Meier einbrach,
zeigtest du mir jeden Schritt.
als ich mir dabei ein Bein brach,
da nahmst du die Beute mit.
Messer immer scharf zu schleifen,
brachtest du mir liebend bei,
nie Revolver anzugreifen,
außer gegen die Polizei.
Mütterlein, Mütterlein,
war mir je etwas nicht klar,
hast du alles mir genau erklärt.
Nur nicht, wer mein Vater war.
Warum kannst du heute nicht mehr bei mir sein?
Wie gern hätt' ich dich noch gehabt!
Doch du brachst vor zwei Jahren in die Länderbank ein,
und dabei haben sie dich geschnappt.
Du sitzt hinter Gittern und sehnst dich heraus
und glaubst gar, man läßt dich im Stich.
Mütterlein, Mütterlein, mach dir nichts draus!
Die Länderbank knack ich für dich.
Mütterlein, Mütterlein,
weilst du jetzt auch fern von mir,
weiß ich doch, es wird nicht lang so sein.
Eines Tags komm ich zu dir.
Reiche Frauen zu vergiften,
lehrtest du mich meisterhaft.
Mit gefälschten Unterschriften
hast du Posten mir verschafft.
Doch ich mußte mich nicht plagen,
denn du zeigtest mir sodann,
wie man Gelder unterschlagen
und den Chef erpressen kann.
Und du brachtest mich zur Grenze,
als es galt, das Land zu fliehn,
gabst mir etwas Schmuggelware
und hast gütig mir verziehn.
Nie warst du mit mir despotisch.
Was du nahmst, das nahmst du schnell.
Glücklich war ich und neurotisch,
sorgenfrei und kriminell.
Kinderlein, Kinderlein,
darum sage ich euch heut:
Habt ihr Freundesgeld, versaufet es!
Habt ihr ein Schwesterlein, verkaufet es!
Habt ihr Kinderlein, verjaget sie!
Habt ihr Ehefrauen, erschlaget sie!
Doch habt ihr noch ein Mütterlein,
macht ihr recht viel Freud!
vabanque - am Sonntag, 25. September 2005, 13:15 - Rubrik: Populaere Kultur Musik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Auf n-tv lesen wir am Donnerstag, 15. September 2005 über einen " 'Überfall auf die nationale Depression'. Der soll im Prinzip genauso ablaufen, wie ein guter Banküberfall". :
Depressionsindex
Alte Männer am glücklichsten
Männer über 60 sind die glücklichsten Deutschen, dicht gefolgt von Frauen zwischen 20 und 29 Jahren. Mit großem Abstand am unglücklichsten sind dagegen Frauen über 60. Dieses Zwischenergebnis präsentierten die Organisatoren des "Deutschen Depressionsbarometers", einer Aktion, die von n-tv.de als Online-Medienpartner unterstützt wird.
Rund 80.000 Menschen haben bereits online Auskunft über Ihre Stimmungslage gegeben. Jetzt gibt es das Barometer auch in der realen Welt: Vor der Berliner Volksbühne wurde eine drei Meter hohe Säule enthüllt, die in den Tagen vor und nach der Wahl weithin sichtbar Auskunft über den nationalen Depressionsindex gibt.
Der liegt derzeit bei knapp 34 Punkten, einem Wert, der schon recht nah an eine bedenkliche Verstimmung heranreicht. "Gesunde Menschen haben normalerweise einen Wert von etwa 17", erläuterte vor Ort der Chef des wissenschaftlichen Beirats des Depressionsbarometers, Fritz B. Simon, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeuthische Medizin, der an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der privaten Universität Witten/Herdecke Führung und Organisation lehrt. Er schließt daraus, dass "die gefühlte Situation und die Erwartungen an die Zukunft in Deutschland tendenziell negativ sind".
Dass sich der Wert in den vergangenen Wochen leicht verbessert hat, bringt Simon mit den anstehenden Wahlen in Zusammenang: "Depression ist immer ein Ausdruck der Hilflosigkeit und Autoaggression. Wenn die Ohnmacht auf vermeintliche Feinde gerichtet werden kann, hat das anti-depressive Wirkung". Günstigere Depressionswerte wurden allerdings auch in Perioden mit schönem Wetter ermittelt.
Noch bis zum 19. November läuft die Aktion, können Interessierte - auch auf n-tv.de - Fragen aus der klinischen Psychiatrie beantworten und so ihren persönlichen Depressionswert ermitteln. Danach starten die Organisatoren vom Management-Zentrum Witten im Rahmen ihrer Tagung "X-Organisationen" einen "Überfall auf die nationale Depression". Der soll im Prinzip genauso ablaufen, wie ein guter Banküberfall. Man darf also gespannt sein.
Möchte ja nicht wissen was auf deren persönlichen Depressionsindex passiert, wenn die wissen würden, dass die Mehrzahl der Banküberfälle in Deutschland von Anfängern und Dilletanten durchgeführt wird, und dass die Beute immer geringer ausfällt ....
Depressionsindex
Alte Männer am glücklichsten
Männer über 60 sind die glücklichsten Deutschen, dicht gefolgt von Frauen zwischen 20 und 29 Jahren. Mit großem Abstand am unglücklichsten sind dagegen Frauen über 60. Dieses Zwischenergebnis präsentierten die Organisatoren des "Deutschen Depressionsbarometers", einer Aktion, die von n-tv.de als Online-Medienpartner unterstützt wird.
Rund 80.000 Menschen haben bereits online Auskunft über Ihre Stimmungslage gegeben. Jetzt gibt es das Barometer auch in der realen Welt: Vor der Berliner Volksbühne wurde eine drei Meter hohe Säule enthüllt, die in den Tagen vor und nach der Wahl weithin sichtbar Auskunft über den nationalen Depressionsindex gibt.
Der liegt derzeit bei knapp 34 Punkten, einem Wert, der schon recht nah an eine bedenkliche Verstimmung heranreicht. "Gesunde Menschen haben normalerweise einen Wert von etwa 17", erläuterte vor Ort der Chef des wissenschaftlichen Beirats des Depressionsbarometers, Fritz B. Simon, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeuthische Medizin, der an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der privaten Universität Witten/Herdecke Führung und Organisation lehrt. Er schließt daraus, dass "die gefühlte Situation und die Erwartungen an die Zukunft in Deutschland tendenziell negativ sind".
Dass sich der Wert in den vergangenen Wochen leicht verbessert hat, bringt Simon mit den anstehenden Wahlen in Zusammenang: "Depression ist immer ein Ausdruck der Hilflosigkeit und Autoaggression. Wenn die Ohnmacht auf vermeintliche Feinde gerichtet werden kann, hat das anti-depressive Wirkung". Günstigere Depressionswerte wurden allerdings auch in Perioden mit schönem Wetter ermittelt.
Noch bis zum 19. November läuft die Aktion, können Interessierte - auch auf n-tv.de - Fragen aus der klinischen Psychiatrie beantworten und so ihren persönlichen Depressionswert ermitteln. Danach starten die Organisatoren vom Management-Zentrum Witten im Rahmen ihrer Tagung "X-Organisationen" einen "Überfall auf die nationale Depression". Der soll im Prinzip genauso ablaufen, wie ein guter Banküberfall. Man darf also gespannt sein.
Möchte ja nicht wissen was auf deren persönlichen Depressionsindex passiert, wenn die wissen würden, dass die Mehrzahl der Banküberfälle in Deutschland von Anfängern und Dilletanten durchgeführt wird, und dass die Beute immer geringer ausfällt ....
contributor - am Montag, 19. September 2005, 16:15 - Rubrik: Lotto und Bankraubphantasien
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
