Wagner, Patrick: Hitlers Kriminalisten. Die deutsche Kriminalpolizei und der Nationalsozialismus zwischen 1920 und 1960 (= Beck'sche Reihe 1498). München: C.H. Beck Verlag 2002. ISBN 3-406-49402-1; 218 S.; EUR 12,90.
Die Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus war lange Zeit ein
Stiefkind der seriösen Geschichtsforschung. Die Kriminalpolizei bildete hier keine Ausnahme und Schriften ehemaliger Kriminalbeamter waren die einzige Informationsquelle. Dies änderte sich erst mit der bahnbrechenden Dissertation Patrick Wagners, die 1996 erschien. Wagner war der erste, der die Aufmerksamkeit der Geschichtswissenschaft auf die Frage nach der Rolle der Kriminalpolizei im Nationalsozialismus lenkte. Nun legt Wagner ein neues Buch vor, welches den prägnanten Titel „Hitlers Kriminalisten“ trägt, und das in weiten Teilen Ergebnisse
seiner Dissertation in kürzerer Form zusammenfasst, aber auch neue
Aspekte bietet.
Die Studie gliedert sich in fünf Teile. Im ersten Teil macht Wagner
deutlich, dass „die zwanziger Jahre eine Phase der Innovation und
Modernisierung [...]“ für die deutsche Kriminalpolizei waren (S. 15).
Vor allem in Berlin, der größten deutschen Kriminalpolizei, führte dies zu einer Spezialisierung der Beamten, die sich an dem modus operandi der Straftäter orientierte. Anzumerken ist, dass Wagner in weiten Teilen die Berliner Kriminalpolizei untersucht und dies mit der späteren Besetzung aller Schlüsselpositionen der deutschen Kripo durch Berliner Kriminalisten treffend begründet. Weitere Forschungen, insbesondere zur Arbeit der Kriminalpolizei in der Provinz sind dennoch wünschenswert. Zu überprüfen wäre etwa, ob und wie weit das Berliner Modell auf die praktische Arbeit der gesamten Kriminalpolizei übertragen wurde. Dies
gilt ungeachtet der Feststellung Wagners, „dass um 1927 der praktische Blick der Berliner Kripo für alle preußischen Kriminalisten verbindlich geworden war“ (S. 20). Das Hauptaugenmerk der Berliner Kripo galt den so
genannten Berufsverbrechern, die sich in den legendären Ringvereinen
organisierten. Während der Weimarer Republik gelang es der
Kriminalpolizei nicht, so Wagner, „die Schweigesolidarität des Milieus auszuhebeln“ (S. 38). Viele Kriminalisten erlebten diese Situation als zutiefst unbefriedigend und wünschten, die rechtstaatlichen Schranken im Umgang mit den so genannten Berufsverbrechern einzureißen. Einzelne Kommissare dienten sich daher bereits vor 1933 der NSDAP an. Unklar bleibt jedoch, wie viele dies waren und wie hoch die personelle Kontinuität im Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus in der Kriminalpolizei war.
Den ganzen Beitrag bei H-Soz-u-Kult lesen
Rezensiert von Carsten Dams, Dokumentations- und Forschungsstelle für Polizei- und Verwaltungsgeschichte, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Münster E-Mail: carsten.dams@gmx.de
Die Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus war lange Zeit ein
Stiefkind der seriösen Geschichtsforschung. Die Kriminalpolizei bildete hier keine Ausnahme und Schriften ehemaliger Kriminalbeamter waren die einzige Informationsquelle. Dies änderte sich erst mit der bahnbrechenden Dissertation Patrick Wagners, die 1996 erschien. Wagner war der erste, der die Aufmerksamkeit der Geschichtswissenschaft auf die Frage nach der Rolle der Kriminalpolizei im Nationalsozialismus lenkte. Nun legt Wagner ein neues Buch vor, welches den prägnanten Titel „Hitlers Kriminalisten“ trägt, und das in weiten Teilen Ergebnisse
seiner Dissertation in kürzerer Form zusammenfasst, aber auch neue
Aspekte bietet.
Die Studie gliedert sich in fünf Teile. Im ersten Teil macht Wagner
deutlich, dass „die zwanziger Jahre eine Phase der Innovation und
Modernisierung [...]“ für die deutsche Kriminalpolizei waren (S. 15).
Vor allem in Berlin, der größten deutschen Kriminalpolizei, führte dies zu einer Spezialisierung der Beamten, die sich an dem modus operandi der Straftäter orientierte. Anzumerken ist, dass Wagner in weiten Teilen die Berliner Kriminalpolizei untersucht und dies mit der späteren Besetzung aller Schlüsselpositionen der deutschen Kripo durch Berliner Kriminalisten treffend begründet. Weitere Forschungen, insbesondere zur Arbeit der Kriminalpolizei in der Provinz sind dennoch wünschenswert. Zu überprüfen wäre etwa, ob und wie weit das Berliner Modell auf die praktische Arbeit der gesamten Kriminalpolizei übertragen wurde. Dies
gilt ungeachtet der Feststellung Wagners, „dass um 1927 der praktische Blick der Berliner Kripo für alle preußischen Kriminalisten verbindlich geworden war“ (S. 20). Das Hauptaugenmerk der Berliner Kripo galt den so
genannten Berufsverbrechern, die sich in den legendären Ringvereinen
organisierten. Während der Weimarer Republik gelang es der
Kriminalpolizei nicht, so Wagner, „die Schweigesolidarität des Milieus auszuhebeln“ (S. 38). Viele Kriminalisten erlebten diese Situation als zutiefst unbefriedigend und wünschten, die rechtstaatlichen Schranken im Umgang mit den so genannten Berufsverbrechern einzureißen. Einzelne Kommissare dienten sich daher bereits vor 1933 der NSDAP an. Unklar bleibt jedoch, wie viele dies waren und wie hoch die personelle Kontinuität im Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus in der Kriminalpolizei war.
Den ganzen Beitrag bei H-Soz-u-Kult lesen
Rezensiert von Carsten Dams, Dokumentations- und Forschungsstelle für Polizei- und Verwaltungsgeschichte, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Münster E-Mail: carsten.dams@gmx.de
contributor - am Mittwoch, 7. April 2004, 00:48 - Rubrik: Techniken der Fahndung und Ueberwachung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
»Bankraub wie im Kino«
titelt die Kölner Rundschau vom 5.4. 2004 über einen Bericht zu einem Bankraub, der offensichtlich generalstabsmässig durchgeführt und bei dem es ziemlich gewalttätig zur Sache ging:
"Stavanger - Bei einem Banküberfall wie aus einem brutalen Actionfilm haben Gangster am Montag in der norwegischen Stadt Stavanger einen Polizisten erschossen. Wie ein Behördensprecher bestätigte, konnten die mindestens acht Bankräuber flüchten."
Weiter im Text
Den gleichen Text gibt es noch ein bisschen aufgemotzter beim österreichischen Kurier (5.4.2004)
Offensichtlich können die Printmedien reale Banküberfall-Szenarien heutzutage sich nur noch im Vergleich zu fiktionalen Filmszenen vorstellen. Das Reale wird hier überformt von der virtuellen Welt des Films. "Bankraub wie im Kino" titelt die niedersächsischen "Neue Presse" (ohne Datum) über einen "perfekt geplanten" und "kaltblütigen" Überfall in Göttingen, bei dem 208.000 Mark abhanden kommen, aber 100.000 Mark "im Tresor liegen" bleiben.
"Filmreif" (BILD, 16.01. 1997) war der "Banküberfall mit dem Hubschrauber" in Offenburg oder "fernsehreif" werden spektakuläre Flucht- und Verfolgungsszenen etwa in Salzburg bezeichnet (Vgl. Kleine Zeitung, 29.01. 2000), wenn es zu Verfolgungsjagden und/oder Schusswechseln mit dem staatlichen Gewaltapparat kommt.
Darüber hinaus ist diese Art der Berichterstattung einmal wieder ein Beleg für die Beobachtung, dass Medien Medien überschätzen. Denn es wird einfach vergessen, dass es diese Zweiteilung zwischen Film und Wirklichkeit schon lange nicht mehr gibt. Ob der Film vom Bankraub oder der Bankraub aus dem Film resultiert, mag zwar medienwissenchaftlich nach wie vor eine interessante Frage sein. Aber für den konkreten Banküberfall ist das schnuppe. Dass in Stavanger ein Banküberfall mit großer Brutalität durchgeführt wird, ist kein Medienprodukt, sondern der Tatsache geschuldet, dass hier eine professionelle und zu allem entschlossene Gangsterbande sich das Ziel gesetzt hat, das Geld dort abzuholen, wo sie es vermuten. Und das hat nichts mit Kino zu tun, sondern ist 'Real Life'.
titelt die Kölner Rundschau vom 5.4. 2004 über einen Bericht zu einem Bankraub, der offensichtlich generalstabsmässig durchgeführt und bei dem es ziemlich gewalttätig zur Sache ging:
"Stavanger - Bei einem Banküberfall wie aus einem brutalen Actionfilm haben Gangster am Montag in der norwegischen Stadt Stavanger einen Polizisten erschossen. Wie ein Behördensprecher bestätigte, konnten die mindestens acht Bankräuber flüchten."
Weiter im Text
Den gleichen Text gibt es noch ein bisschen aufgemotzter beim österreichischen Kurier (5.4.2004)
Offensichtlich können die Printmedien reale Banküberfall-Szenarien heutzutage sich nur noch im Vergleich zu fiktionalen Filmszenen vorstellen. Das Reale wird hier überformt von der virtuellen Welt des Films. "Bankraub wie im Kino" titelt die niedersächsischen "Neue Presse" (ohne Datum) über einen "perfekt geplanten" und "kaltblütigen" Überfall in Göttingen, bei dem 208.000 Mark abhanden kommen, aber 100.000 Mark "im Tresor liegen" bleiben.
"Filmreif" (BILD, 16.01. 1997) war der "Banküberfall mit dem Hubschrauber" in Offenburg oder "fernsehreif" werden spektakuläre Flucht- und Verfolgungsszenen etwa in Salzburg bezeichnet (Vgl. Kleine Zeitung, 29.01. 2000), wenn es zu Verfolgungsjagden und/oder Schusswechseln mit dem staatlichen Gewaltapparat kommt.
Darüber hinaus ist diese Art der Berichterstattung einmal wieder ein Beleg für die Beobachtung, dass Medien Medien überschätzen. Denn es wird einfach vergessen, dass es diese Zweiteilung zwischen Film und Wirklichkeit schon lange nicht mehr gibt. Ob der Film vom Bankraub oder der Bankraub aus dem Film resultiert, mag zwar medienwissenchaftlich nach wie vor eine interessante Frage sein. Aber für den konkreten Banküberfall ist das schnuppe. Dass in Stavanger ein Banküberfall mit großer Brutalität durchgeführt wird, ist kein Medienprodukt, sondern der Tatsache geschuldet, dass hier eine professionelle und zu allem entschlossene Gangsterbande sich das Ziel gesetzt hat, das Geld dort abzuholen, wo sie es vermuten. Und das hat nichts mit Kino zu tun, sondern ist 'Real Life'.
vabanque - am Montag, 5. April 2004, 23:54 - Rubrik: Bankraub in Film und Fernsehen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
unter diesem Titel veranstaltet Zátopek im Club Voltaire in Tübingen am Dienstag, 27.4. 2004 einen multimedialen Abend "über jüdische Gangster in New York, im Film und in unseren Köpfen" mit der Kulturwissenschaftlerin Andrea Hoffmann (Autorin "Vabanque").
vabanque - am Sonntag, 4. April 2004, 13:56 - Rubrik: Jewish Studies
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Eine etwas schwülstige Pressemitteilung des ZDF in Sachen Dimitri Todorov. Dabei ist das doch was ganz anderes, wenn man ihn mal selbst live mitbekommen hat.
Etwas besser dürfte diese Radiosendung aus von Radio Z (Nürnberg) sein.
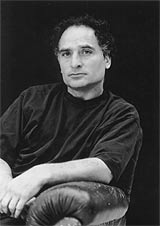
Mainz (ots) - Endstation Freiheit
ZDF-Dokumentation aus der Reihe "37°" über das Leben nach 30 Jahren Haft Dimitri Todorov war die meiste Zeit seines Lebens in Haft. Nach 30 Jahren hinter Gefängnismauern versucht der 56-Jährige nun ein neues Leben zu beginnen. Die ZDF-Dokumentation "Endstation Freiheit" aus der Reihe "37°" begleitet am Dienstag, 6. April 2004, 22.15 Uhr, den ehemaligen Geiselnehmer und Freund von Liedermacher Konstantin Wecker bei seiner Sinnsuche in Freiheit. Der Film von Broka Hermann erzählt die Geschichte des Mannes, der beim Hofgang im Straubinger Gefängnis schon zweimal um die Welt gelaufen ist und dort 22 Jahre für eine spektakuläre Tat büßte: Im Herbst 1971 beendete in München eine wilde Schießerei mit zwei Toten den ersten Banküberfall mit Geiselnahme in Deutschland. Nach der offiziellen Version des Tathergangs soll Todorovs Komplize die Geisel erschossen haben, nachdem er selbst von den Scharfschützen der Polizei tödlich verwundet worden war. Todorov sitzt heute nach über 30 Jahren Gefängnis in einer Einzimmerwohnung und denkt - wie schon jahrelang in der Gefängniszelle - zurück an den Tod der Geisel, an die Schießerei, an Schuld und Sühne.
Todorov sammelt heute Essensreste von Lokalen ein und verteilt sie an Bedürftige oder an Kindergärten. Er ist immer noch befreundet mit Konstantin Wecker, den er im Jugendgefängnis kennen lernte. Der Chansonnier äußert sich in Hermanns Film zu dieser langjährigen
Freundschaft und zu dem Thema, das Todorov umtreibt: Wie wurde us dem jungen Kriminellen, der die Polizei, das Kapital, den ganzen
Staat herausfordern wollte, in 30 Jahren Monotonie ein "Häftling"
durch und durch - und was ist er jetzt? Was kann er noch sein? Wo
findet er wirklich zur Freiheit? " Dimitri Todorov ist auf der Suche
nach sich selbst.
Etwas besser dürfte diese Radiosendung aus von Radio Z (Nürnberg) sein.
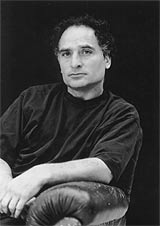
Mainz (ots) - Endstation Freiheit
ZDF-Dokumentation aus der Reihe "37°" über das Leben nach 30 Jahren Haft Dimitri Todorov war die meiste Zeit seines Lebens in Haft. Nach 30 Jahren hinter Gefängnismauern versucht der 56-Jährige nun ein neues Leben zu beginnen. Die ZDF-Dokumentation "Endstation Freiheit" aus der Reihe "37°" begleitet am Dienstag, 6. April 2004, 22.15 Uhr, den ehemaligen Geiselnehmer und Freund von Liedermacher Konstantin Wecker bei seiner Sinnsuche in Freiheit. Der Film von Broka Hermann erzählt die Geschichte des Mannes, der beim Hofgang im Straubinger Gefängnis schon zweimal um die Welt gelaufen ist und dort 22 Jahre für eine spektakuläre Tat büßte: Im Herbst 1971 beendete in München eine wilde Schießerei mit zwei Toten den ersten Banküberfall mit Geiselnahme in Deutschland. Nach der offiziellen Version des Tathergangs soll Todorovs Komplize die Geisel erschossen haben, nachdem er selbst von den Scharfschützen der Polizei tödlich verwundet worden war. Todorov sitzt heute nach über 30 Jahren Gefängnis in einer Einzimmerwohnung und denkt - wie schon jahrelang in der Gefängniszelle - zurück an den Tod der Geisel, an die Schießerei, an Schuld und Sühne.
Todorov sammelt heute Essensreste von Lokalen ein und verteilt sie an Bedürftige oder an Kindergärten. Er ist immer noch befreundet mit Konstantin Wecker, den er im Jugendgefängnis kennen lernte. Der Chansonnier äußert sich in Hermanns Film zu dieser langjährigen
Freundschaft und zu dem Thema, das Todorov umtreibt: Wie wurde us dem jungen Kriminellen, der die Polizei, das Kapital, den ganzen
Staat herausfordern wollte, in 30 Jahren Monotonie ein "Häftling"
durch und durch - und was ist er jetzt? Was kann er noch sein? Wo
findet er wirklich zur Freiheit? " Dimitri Todorov ist auf der Suche
nach sich selbst.
- Vgl. a. die Webseite der Sendung von 37 Grad beim ZDF
- Weitere Links zu Dimitri Todorov bei Zátopek im Club Voltaire Tübingen sowie ein Veranstaltungsbericht im Schwäbischen Tagblatt vom April 2003
- Ebenso eine Live-Konserve von einer Lesung im Club Voltaire München vom 7. Juli 2003.
contributor - am Samstag, 3. April 2004, 22:09 - Rubrik: Bankraub-Dokus - Themenabende usw.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Heise-News, 3.4.2004
SMS-Fahndung droht zu floppen
Die SMS-Fahndung nach Straftätern mit Hilfe der Bevölkerung stößt nicht nur auf heftige Kritik, sondern auch auf technische Bedenken seitens der meisten Bundesländer. Mit dem System will Bundesinnenminister Otto Schily Passanten als Fahndungshelfer heranziehen. Beispielsweise nach einem Banküberfall soll die Polizei Täterbeschreibungen an die Handys von Bürgern in der Region schicken, die sich für diesen Dienst registriert haben. Diese sollen dann die "Augen aufhalten und möglicherweise sogar den entscheidenden Hinweis geben", wie es auf dem SMS-Fahndungsportal der Deutschen Polizei heißt.
Der Spiegel berichtet jedoch in seiner neuesten Ausgabe davon, dass das Projekt zu floppen drohe. Derzeit setze nur das Polizeipräsidium Bochum diese Fahndungsform ein. Dort sollen sich 450 Bürger registriert haben. Trotz der Bedenken aus den Bundesländern beharrt Schily darauf, dass sich das Projekt in Tests als "technisch und rechtlich realisierbar" erwiesen habe. (mw/c't)
SMS-Fahndung droht zu floppen
Die SMS-Fahndung nach Straftätern mit Hilfe der Bevölkerung stößt nicht nur auf heftige Kritik, sondern auch auf technische Bedenken seitens der meisten Bundesländer. Mit dem System will Bundesinnenminister Otto Schily Passanten als Fahndungshelfer heranziehen. Beispielsweise nach einem Banküberfall soll die Polizei Täterbeschreibungen an die Handys von Bürgern in der Region schicken, die sich für diesen Dienst registriert haben. Diese sollen dann die "Augen aufhalten und möglicherweise sogar den entscheidenden Hinweis geben", wie es auf dem SMS-Fahndungsportal der Deutschen Polizei heißt.
Der Spiegel berichtet jedoch in seiner neuesten Ausgabe davon, dass das Projekt zu floppen drohe. Derzeit setze nur das Polizeipräsidium Bochum diese Fahndungsform ein. Dort sollen sich 450 Bürger registriert haben. Trotz der Bedenken aus den Bundesländern beharrt Schily darauf, dass sich das Projekt in Tests als "technisch und rechtlich realisierbar" erwiesen habe. (mw/c't)
contributor - am Samstag, 3. April 2004, 22:03 - Rubrik: Techniken der Fahndung und Ueberwachung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wien ist offensichtlich gegenwärtig die Hauptstadt des Bankraubs im deutschsprachigen Raum. Das Online-Portal der Kronen Zeitung jedenfalls berichtete am 3.4. 2004:
22 Banküberfälle in nur 3 Monaten
Alarmierender Anstieg der Banküberfälle in Wien: Während im ganzen vergangenen Jahr in der Bundeshauptstadt 51 Banken ausgeraubt wurden, musste die Polizei heuer in den ersten drei Monaten bereits zu 22 Überfällen ausrücken.
Weiter im Orginal ...
Natürlich meldet sich bei solchen Gelegenheitne das kriminelle Pack von österreichischen Steuerhinterziehern, Versicherungsbetrügern und Bestechlichen auch gleich zu Wort wie bei Vienna Online (2.4.2004) oder bei Die Presse.com (2.4.2004) (jeweils am Ende des Artikels), die Kriminalität vor allem bei den Ausländern denunzieren. Aber auf die FPÖ-Bankräuberwitwe Magda Bleckmann-Jost, werden wir hier auch noch zu sprechen kommen. Vgl. a. den Kommentar ("Leserbrief") von Sonja Brünzels auf dem Online-Portal von Die Presse.
22 Banküberfälle in nur 3 Monaten
Alarmierender Anstieg der Banküberfälle in Wien: Während im ganzen vergangenen Jahr in der Bundeshauptstadt 51 Banken ausgeraubt wurden, musste die Polizei heuer in den ersten drei Monaten bereits zu 22 Überfällen ausrücken.
Weiter im Orginal ...
Natürlich meldet sich bei solchen Gelegenheitne das kriminelle Pack von österreichischen Steuerhinterziehern, Versicherungsbetrügern und Bestechlichen auch gleich zu Wort wie bei Vienna Online (2.4.2004) oder bei Die Presse.com (2.4.2004) (jeweils am Ende des Artikels), die Kriminalität vor allem bei den Ausländern denunzieren. Aber auf die FPÖ-Bankräuberwitwe Magda Bleckmann-Jost, werden wir hier auch noch zu sprechen kommen. Vgl. a. den Kommentar ("Leserbrief") von Sonja Brünzels auf dem Online-Portal von Die Presse.
contributor - am Samstag, 3. April 2004, 21:33 - Rubrik: Wien 2004
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Norwegen: Gesuchter Mörder sah ,Passion’ und stellte sich Polizei
Die katholisch-fundamentalistische Nachrichtenagentur kath-net (29.3.2004) sammelt - nachdem sie bereits von einem bekehrten us-amerikanischen Bankräuber berichtete - weitere Geschichten von angeblichen Bekehrungen durch Mel Gibsons Balkensepp-Splatter. Es soll darüber hinaus noch die Bekehrung von einem leichtgläubigen Bankräuber und Mörder gegeben haben (siehe Link). Na, wenn Gibsons Film Neo-Nazis aus dem Verkehr ziehen hilft, soll es uns recht sein und schließlich hat der Streifen damit auch das Publikum das er verdient:
“Vorsicht, dieser Film könnte Ihr Leben verändern”, müsste auf jeder Kinokarte für “Die Passion Christi” stehen: Erneut hat sich ein Krimineller bekehrt.
Oslo (www.kath.net) „Die Passion Christi“ kann das Leben verändern. Das bestätigt der Fall eines gesuchten norwegischen Mörders und Neo-Nazis, von dem die Zeitung „Dagbladet“ berichtet. Johnny Olsen stellte sich am Samstag der Polizei und bekannte, er sei für zwei Bombenanschläge in den 90er Jahren im linksautonomen Kulturzentrum „Blitz“ in Oslo verantwortlich.
Weiter im Text ...

Die katholisch-fundamentalistische Nachrichtenagentur kath-net (29.3.2004) sammelt - nachdem sie bereits von einem bekehrten us-amerikanischen Bankräuber berichtete - weitere Geschichten von angeblichen Bekehrungen durch Mel Gibsons Balkensepp-Splatter. Es soll darüber hinaus noch die Bekehrung von einem leichtgläubigen Bankräuber und Mörder gegeben haben (siehe Link). Na, wenn Gibsons Film Neo-Nazis aus dem Verkehr ziehen hilft, soll es uns recht sein und schließlich hat der Streifen damit auch das Publikum das er verdient:
“Vorsicht, dieser Film könnte Ihr Leben verändern”, müsste auf jeder Kinokarte für “Die Passion Christi” stehen: Erneut hat sich ein Krimineller bekehrt.
Oslo (www.kath.net) „Die Passion Christi“ kann das Leben verändern. Das bestätigt der Fall eines gesuchten norwegischen Mörders und Neo-Nazis, von dem die Zeitung „Dagbladet“ berichtet. Johnny Olsen stellte sich am Samstag der Polizei und bekannte, er sei für zwei Bombenanschläge in den 90er Jahren im linksautonomen Kulturzentrum „Blitz“ in Oslo verantwortlich.
Weiter im Text ...
vabanque - am Dienstag, 30. März 2004, 14:41 - Rubrik: Volksglaube
Eine wahre Geschichte<
Alex Capus: Fast ein bißchen Frühling. Roman. Residenz Verlag Salzburg. 175 Seiten, gebunden, 17,90 EUR.
"Es ist geradezu bitterkalt im Winter des Jahres 1933/34 in Westeuropa mit klirrendem Frost und Rekordminustemperaturen, als die beiden jungen Deutschen Kurt Sandweg und Waldemar Velte in Basel auftauchen. Von Frühling keine Spur! Beide sind arbeitslos, planen auszuwandern und haben sich das nötige Reisegeld bei einem Bankraub besorgt. Dabei hat es Tote gegeben. Doch davon wissen die beiden jungen Verkäuferinnen Dorly und Marie - sie ist die Großmutter des Erzählers - nichts."
Weiterlesen im »Neuen Deutschland« vom 14.06.2002
Weitere Rezensionen
literaturkritik.de » Nr. 6, Juni 2003
FAZ (18.4.2002)

Alex Capus: Fast ein bißchen Frühling. Roman. Residenz Verlag Salzburg. 175 Seiten, gebunden, 17,90 EUR.
"Es ist geradezu bitterkalt im Winter des Jahres 1933/34 in Westeuropa mit klirrendem Frost und Rekordminustemperaturen, als die beiden jungen Deutschen Kurt Sandweg und Waldemar Velte in Basel auftauchen. Von Frühling keine Spur! Beide sind arbeitslos, planen auszuwandern und haben sich das nötige Reisegeld bei einem Bankraub besorgt. Dabei hat es Tote gegeben. Doch davon wissen die beiden jungen Verkäuferinnen Dorly und Marie - sie ist die Großmutter des Erzählers - nichts."
Weiterlesen im »Neuen Deutschland« vom 14.06.2002
Weitere Rezensionen
literaturkritik.de » Nr. 6, Juni 2003
FAZ (18.4.2002)
vabanque - am Montag, 29. März 2004, 23:49 - Rubrik: Literatur und Bankraub
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Ein TAZ-Interview (19.10.2002) im Berliner Lokalteil anlässlich der Beobachtung, dass im Jahr 2002 in Berlin die Zahl der Banküberfälle wieder gestiegen sind. Und natürlich geht es wieder los, mit dem unvermeidlichen Brecht-Zitat:
"Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?", fragte Bertolt Brechts Mackie Messer.
Der Kulturwissenschaftler Klaus Schönberger hat sich mit der Theorie und Praxis des Bankraubwesens beschäftigt
taz: Was interessiert Sie an Banküberfällen?
Klaus Schönberger: Es gibt zwei verbreitete Kollektivfantasien: im Lotto zu gewinnen und eine Bank zu überfallen. Interessant ist auch, dass die soziale Frage neu verhandelt wird. Leute eignen sich etwas an, das ihnen nicht gehört. Sie haben eine andere Vorstellung von der Verteilung, wie auch immer man das bewertet.
Das ganze Interview lesen …
"Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?", fragte Bertolt Brechts Mackie Messer.
Der Kulturwissenschaftler Klaus Schönberger hat sich mit der Theorie und Praxis des Bankraubwesens beschäftigt
taz: Was interessiert Sie an Banküberfällen?
Klaus Schönberger: Es gibt zwei verbreitete Kollektivfantasien: im Lotto zu gewinnen und eine Bank zu überfallen. Interessant ist auch, dass die soziale Frage neu verhandelt wird. Leute eignen sich etwas an, das ihnen nicht gehört. Sie haben eine andere Vorstellung von der Verteilung, wie auch immer man das bewertet.
Das ganze Interview lesen …
contributor - am Sonntag, 28. März 2004, 22:59 - Rubrik: Lotto und Bankraubphantasien
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Wie bereits angekündigt, lief am 1. März 2004 bei »Planet Wissen« im WDR/SWR die Themensendung «Bankraub«.
 Vom Inhaltlichen ist vielleicht anzumerken, dass die Redaktion offensichtlich bemüht war, nicht in den Verdacht von allzuviel Sympathie zu geraten. Jedenfalls ist der ganzen Sendung die Tendenz anzumerken, zu betonen, wie wenig Sinn es heute noch machen soll, eine Bank zu überrauben. Das sehen die Täter in der Regel anders, insofern sind solche volkspädagogischen Bemühungen in der Regel auch für die Katz. Ehrlicher wäre gewesen, zuzugeben, dass sie das am liebsten auch gerne machen würden ... aber in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wäre das wohl zu viel verlangt.
Vom Inhaltlichen ist vielleicht anzumerken, dass die Redaktion offensichtlich bemüht war, nicht in den Verdacht von allzuviel Sympathie zu geraten. Jedenfalls ist der ganzen Sendung die Tendenz anzumerken, zu betonen, wie wenig Sinn es heute noch machen soll, eine Bank zu überrauben. Das sehen die Täter in der Regel anders, insofern sind solche volkspädagogischen Bemühungen in der Regel auch für die Katz. Ehrlicher wäre gewesen, zuzugeben, dass sie das am liebsten auch gerne machen würden ... aber in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wäre das wohl zu viel verlangt.
Etwas ärgerlich ist allerdings, dass dann bei den Ideen von KollegInnen, wie etwa den AutorInnen des Buches «Vabanque«, das letztlich die Idee und die inhaltliche Grundlage der gesamten Sendung lieferte, weniger skrupulös vorgegangen wird. Dieser Befund bezieht sich in erster Line auf die eine Webpage zur Sendung, auf der ziemlich freizügig Ideen und Formulierungen übernommen wurden - ohne das wirklich sachlich richtig auszuweisen.
Das Leben ist hart, und der nächste Bankraub, äh, Ideenklau - ist immer der Schwerste, Na ja, vielleicht auch kein Zufall bei so einem Thema, aber muss es immer gleich so offenkundig sein?
 Vom Inhaltlichen ist vielleicht anzumerken, dass die Redaktion offensichtlich bemüht war, nicht in den Verdacht von allzuviel Sympathie zu geraten. Jedenfalls ist der ganzen Sendung die Tendenz anzumerken, zu betonen, wie wenig Sinn es heute noch machen soll, eine Bank zu überrauben. Das sehen die Täter in der Regel anders, insofern sind solche volkspädagogischen Bemühungen in der Regel auch für die Katz. Ehrlicher wäre gewesen, zuzugeben, dass sie das am liebsten auch gerne machen würden ... aber in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wäre das wohl zu viel verlangt.
Vom Inhaltlichen ist vielleicht anzumerken, dass die Redaktion offensichtlich bemüht war, nicht in den Verdacht von allzuviel Sympathie zu geraten. Jedenfalls ist der ganzen Sendung die Tendenz anzumerken, zu betonen, wie wenig Sinn es heute noch machen soll, eine Bank zu überrauben. Das sehen die Täter in der Regel anders, insofern sind solche volkspädagogischen Bemühungen in der Regel auch für die Katz. Ehrlicher wäre gewesen, zuzugeben, dass sie das am liebsten auch gerne machen würden ... aber in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wäre das wohl zu viel verlangt. Etwas ärgerlich ist allerdings, dass dann bei den Ideen von KollegInnen, wie etwa den AutorInnen des Buches «Vabanque«, das letztlich die Idee und die inhaltliche Grundlage der gesamten Sendung lieferte, weniger skrupulös vorgegangen wird. Dieser Befund bezieht sich in erster Line auf die eine Webpage zur Sendung, auf der ziemlich freizügig Ideen und Formulierungen übernommen wurden - ohne das wirklich sachlich richtig auszuweisen.
Das Leben ist hart, und der nächste Bankraub, äh, Ideenklau - ist immer der Schwerste, Na ja, vielleicht auch kein Zufall bei so einem Thema, aber muss es immer gleich so offenkundig sein?
vabanque - am Sonntag, 28. März 2004, 21:15 - Rubrik: Bankraub-Dokus - Themenabende usw.
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Horst Fantazzini ist am 24. Dezember 2001 im Gefängnis von Dozza gestorben. Banküberfälle, Flucht- und Ausbruchversuche machten Horst Fantazzini zum Häftling mit der längsten Haftstrafe in Italien.

Bei Indymedia Österreich
A colloquio con Horst Fantazzini, una vita in carcere: fine pena 2022

Bei Indymedia Österreich
A colloquio con Horst Fantazzini, una vita in carcere: fine pena 2022
vabanque - am Freitag, 26. März 2004, 23:42 - Rubrik: Biographien des Bankraubs
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Das ist ein typischer Verlauf. Die Sicherheitsvorkehrungen der Banken schützen zuerst das Geld. Ausbaden müssen es dann die Schwächeren und Wehrlosen in und vor den Schalterräumen.
Nachdem die Banken in Folge des Anstiegs von Banküberfällen in den 60er Jahren begannen, Sicherheitsglas usw. einzusetzen, gab es auch die ersten Geiselnahmen. Das war schon damals eine trickreiche Form der Sozialisierung der Kriminalität seitens der Banken.
Immer mehr Überfälle nach Bankomatbesuch
berichtet der ORF (24.3.2004) unter Berufung auf die Wiener Polizei
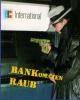 "Die Wiener Polizei warnt vor Überfällen nach Geldbehebungen am Bankomaten. Die Statistik ist eindeutig: 2003 wurden 154 Personen ausgeraubt, im Jahr davor waren es nur rund 30.
"Die Wiener Polizei warnt vor Überfällen nach Geldbehebungen am Bankomaten. Die Statistik ist eindeutig: 2003 wurden 154 Personen ausgeraubt, im Jahr davor waren es nur rund 30.
Ältere Menschen "beliebte" Opfer
Ältere Personen sind besonders gefährdet, nach einem Bankbesuch überfallen zu werden. Sie sind "beliebte" Opfer, da sie oft auf einmal hohe Geldbeträge abheben.
Meist vor Bank überfallen
Meist werden diese Personen von einem der Täter beobachtet und außerhalb der Bank überfallen. Das Geld wird dann an einen Komplizen weitergegeben.
Mehrere Sicherheitstipps
Älteren Menschen rät Peter Jedelsky vom Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst, sich begleiten zu lassen und zu überlegen, ob man diese Geldbehebung wirklich benötigt.
Weiters sollte man aufpassen, nicht beobachtet zu werden. Auch Behebungen in so genannten diskreten Zonen wären sinnvoll, so Jedelsky.
Am sichersten ist es aber laut Jedelsky, möglichst auf bargeldlosen Verkehr umzusteigen."
Aha, solche Tips gibt die Wiener Polizei. Und glauben die wirklich, wenn Bargeld eine geringere Rolle spielt, dass dann beispielsweise das Problem der Beschaffungskriminalität behoben ist? Der beste chutz vor dieser Sorte Kriminalität ist die Entkriminalisierung des Drogengebrauchs. Aber daran hat auch die Polizei kein Interesse, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Via Warteschlange
Nachdem die Banken in Folge des Anstiegs von Banküberfällen in den 60er Jahren begannen, Sicherheitsglas usw. einzusetzen, gab es auch die ersten Geiselnahmen. Das war schon damals eine trickreiche Form der Sozialisierung der Kriminalität seitens der Banken.
Immer mehr Überfälle nach Bankomatbesuch
berichtet der ORF (24.3.2004) unter Berufung auf die Wiener Polizei
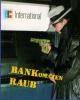 "Die Wiener Polizei warnt vor Überfällen nach Geldbehebungen am Bankomaten. Die Statistik ist eindeutig: 2003 wurden 154 Personen ausgeraubt, im Jahr davor waren es nur rund 30.
"Die Wiener Polizei warnt vor Überfällen nach Geldbehebungen am Bankomaten. Die Statistik ist eindeutig: 2003 wurden 154 Personen ausgeraubt, im Jahr davor waren es nur rund 30. Ältere Menschen "beliebte" Opfer
Ältere Personen sind besonders gefährdet, nach einem Bankbesuch überfallen zu werden. Sie sind "beliebte" Opfer, da sie oft auf einmal hohe Geldbeträge abheben.
Meist vor Bank überfallen
Meist werden diese Personen von einem der Täter beobachtet und außerhalb der Bank überfallen. Das Geld wird dann an einen Komplizen weitergegeben.
Mehrere Sicherheitstipps
Älteren Menschen rät Peter Jedelsky vom Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst, sich begleiten zu lassen und zu überlegen, ob man diese Geldbehebung wirklich benötigt.
Weiters sollte man aufpassen, nicht beobachtet zu werden. Auch Behebungen in so genannten diskreten Zonen wären sinnvoll, so Jedelsky.
Am sichersten ist es aber laut Jedelsky, möglichst auf bargeldlosen Verkehr umzusteigen."
Aha, solche Tips gibt die Wiener Polizei. Und glauben die wirklich, wenn Bargeld eine geringere Rolle spielt, dass dann beispielsweise das Problem der Beschaffungskriminalität behoben ist? Der beste chutz vor dieser Sorte Kriminalität ist die Entkriminalisierung des Drogengebrauchs. Aber daran hat auch die Polizei kein Interesse, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Via Warteschlange
contributor - am Mittwoch, 24. März 2004, 20:43 - Rubrik: Techniken der Fahndung und Ueberwachung
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Eine schöne Sammlung von Links zu Besprechungen der Verfilmung der Beruftstätigkeit der Gebrüder Sass aus dem Jahr 2001 ist bei <www.filmz.de> zu finden.
Darunter auch eine kritische Besprechung von Klaus Schönberger, dem Herausgeber von "Vabanque", im Tübinger Schwäbischen Tagblatt.
vabanque - am Mittwoch, 24. März 2004, 11:28 - Rubrik: Bankraub in Film und Fernsehen
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
"Durch Geld ist alles zu haben! Auch Dynamit. Haben Revolutionäre Geld,so werden sie auch Dynamit bekommen. Ohne jenes können sie dieses weder machen, noch kaufen. Da der Ankauf von Dynamit leichter und billiger ist, als dessen Privat-Herstellung, so wird man es eben kaufen. Ergo lautet die Parole: Thut Geld in Euren Beutel! Null von Null geht nicht, werdet ihr sagen. Da wir nichts haben, müssen auch die Beutel leer bleiben. Das Geld befindet sich eben in den Beuteln anderer Leute. Wie es da heraus praktizirt werden kann, wird immer des Pudels Kern bleiben ..."
Aus: Johann Most: Revolutionäre Kriegswissenschaft. Ein Handbüchlein zur Anleitung betreffend Gebrauches und Herstellung von Nitro-Glycerin, Dynamit, Schießbaumwolle, Knallquecksilber, Bomben, Brandsätzen, Giften usw. Nachdruck nach der Ausgabe New York 1885 mit einer Auskunft über den Autor von H. M. Enzensberger. Rixdorfer Verlagsanstalt 1980, S. 10.
Zur Biographie des Augsburger Anarchisten Johannes Most
Aus: Johann Most: Revolutionäre Kriegswissenschaft. Ein Handbüchlein zur Anleitung betreffend Gebrauches und Herstellung von Nitro-Glycerin, Dynamit, Schießbaumwolle, Knallquecksilber, Bomben, Brandsätzen, Giften usw. Nachdruck nach der Ausgabe New York 1885 mit einer Auskunft über den Autor von H. M. Enzensberger. Rixdorfer Verlagsanstalt 1980, S. 10.
Zur Biographie des Augsburger Anarchisten Johannes Most
vabanque - am Mittwoch, 24. März 2004, 11:18 - Rubrik: Politischer Bankraub
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Schwäbisches Tagblatt, 24.3.2004
"Inge Viett war aktiv bei der „Bewegung 2. Juni“ und der RAF, wurde in den 70er Jahren als „Top-Terroristin“ gesucht, tauchte 1982 in der DDR unter und saß von 1990 an sieben Jahre im Gefängnis. Vor rund 90 Leuten las sie im Reutlinger Café Nepomuk aus ihrem Buch „Nie war ich furchtloser“ und stellte sich den Fragen aus dem Publikum.
(...)
Ihre erste Zeit im Untergrund beschrieb sie geradezu euphorisch: Sie sei von einem „stolzen Gefühl der Hingabe“ erfüllt gewesen. „Der übermächtige Imperialismus hatte seine Kraft verloren. Wir bekämpften alles – und vor allem die Banken“. Nach der Auflösung der “Bewegung 2. Juni“ schloss sie sich 1980 der RAF an."
Zur Biographie von Inge Viett

"Inge Viett war aktiv bei der „Bewegung 2. Juni“ und der RAF, wurde in den 70er Jahren als „Top-Terroristin“ gesucht, tauchte 1982 in der DDR unter und saß von 1990 an sieben Jahre im Gefängnis. Vor rund 90 Leuten las sie im Reutlinger Café Nepomuk aus ihrem Buch „Nie war ich furchtloser“ und stellte sich den Fragen aus dem Publikum.
(...)
Ihre erste Zeit im Untergrund beschrieb sie geradezu euphorisch: Sie sei von einem „stolzen Gefühl der Hingabe“ erfüllt gewesen. „Der übermächtige Imperialismus hatte seine Kraft verloren. Wir bekämpften alles – und vor allem die Banken“. Nach der Auflösung der “Bewegung 2. Juni“ schloss sie sich 1980 der RAF an."
Zur Biographie von Inge Viett
vabanque - am Mittwoch, 24. März 2004, 10:34 - Rubrik: Politischer Bankraub
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Sowas muss wohl unter der Überschrift "Witze" abgelegt werden
Sowas muss wohl unter der Überschrift "Witze" abgelegt werdenvabanque - am Mittwoch, 24. März 2004, 01:57 - Rubrik: witze jokes humor
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Centre de recherches interdisciplinaires sur l'Allemagne (CRIA) Paris
28.02.2004, Paris
Tagungsbericht von Jakob Vogel
Journée d'étude: " Le criminel. L'action humaine entre discours et
pratique quotidienne au XIXe siècle. Une comparaison entre la France et l'Allemagne "
(…)
Die von der Fondation Maison Heinrich Heine unterstützte Veranstaltung vereinte ca. 20 Teilnehmer aus beiden Ländern. Ausgangspunkt waren Überlegungen von Falk BRETSCHNEIDER (CRIA Paris), der dazu aufrief, die bislang stark diskurszentrierten Forschungen zur Kriminalität im 19. Jahrhundert durch eine eher handlungsorientierte Analyse der Reaktionen von "Kriminellen" auf die ihnen diskursiv zugewiesenen Klassifikationen zu ergänzen. Der Titel der Tagung, "Le criminel. L'action humaine entre discours et pratique quotidienne au XIXe siècle. Une comparaison entre la France et l'Allemagne", rückte dabei die durchaus kontroverse These in den Mittelpunkt, daß häufiger als oft angenommen Menschen in der Vergangenheit in der Lage waren, eigene Lebensentwürfe gegen determinierende Normen durchzusetzen. Sie vermochten mit den "herrschenden" Diskursen quasi zu verhandeln und ihnen eigene Freiräume abzuringen. Diese These versprach eine interessante neue Perspektive auf die Kriminalitätsforschung, da die individuellen Handlungsmöglichkeiten hier kaum getrennt von der Frage der Macht betrachtet werden können.
(…)
Mit seinen Beiträgen und Diskussionen, die sich immer wieder um den Status der jeweiligen Quellen, ihre Materialität und die ihnen eigenen Perspektiven drehten, erwies der Workshop die Chancen einer Kriminalitätsgeschichte, welche die Anregungen Foucaults
weiterentwickelt und die Frage nach der "Opferrolle" des Kriminellen im System des Strafvollzugs neu in den Blick nimmt. Wie die angeregten Debatten zeigten, gerät damit die Konstruktion der jeweiligen "Diskurse" in doppelter Hinsicht in den Blick: zum einen als Frage an den Forscher nach den Eigenheiten der einzelnen zeitgenössischen Diskurse über die Person des Kriminellen (wobei die Quellen aus der Expertenperspektive naturgemäß reichhaltiger fließen), zum anderen aber auch nach der Perspektive, welche die Auswahl von unterschiedlichen Quellengattungen für die historiographische Behandlung des Themas impliziert. Experten und "Betroffene", "Beobachter", Täter und Opfer erscheinen dabei gleichermaßen, aber in unterschiedlicher, machtdurchwirkter Weise als Akteure wechselnder "Sprachspiele" um den Kriminellen, zu deren Entwirrung der deutsch-französische Workshop einen wichtigen Beitrag geleistet hat.
Den ganzen Tagungsbericht lesen ...
28.02.2004, Paris
Tagungsbericht von Jakob Vogel
Journée d'étude: " Le criminel. L'action humaine entre discours et
pratique quotidienne au XIXe siècle. Une comparaison entre la France et l'Allemagne "
(…)
Die von der Fondation Maison Heinrich Heine unterstützte Veranstaltung vereinte ca. 20 Teilnehmer aus beiden Ländern. Ausgangspunkt waren Überlegungen von Falk BRETSCHNEIDER (CRIA Paris), der dazu aufrief, die bislang stark diskurszentrierten Forschungen zur Kriminalität im 19. Jahrhundert durch eine eher handlungsorientierte Analyse der Reaktionen von "Kriminellen" auf die ihnen diskursiv zugewiesenen Klassifikationen zu ergänzen. Der Titel der Tagung, "Le criminel. L'action humaine entre discours et pratique quotidienne au XIXe siècle. Une comparaison entre la France et l'Allemagne", rückte dabei die durchaus kontroverse These in den Mittelpunkt, daß häufiger als oft angenommen Menschen in der Vergangenheit in der Lage waren, eigene Lebensentwürfe gegen determinierende Normen durchzusetzen. Sie vermochten mit den "herrschenden" Diskursen quasi zu verhandeln und ihnen eigene Freiräume abzuringen. Diese These versprach eine interessante neue Perspektive auf die Kriminalitätsforschung, da die individuellen Handlungsmöglichkeiten hier kaum getrennt von der Frage der Macht betrachtet werden können.
(…)
Mit seinen Beiträgen und Diskussionen, die sich immer wieder um den Status der jeweiligen Quellen, ihre Materialität und die ihnen eigenen Perspektiven drehten, erwies der Workshop die Chancen einer Kriminalitätsgeschichte, welche die Anregungen Foucaults
weiterentwickelt und die Frage nach der "Opferrolle" des Kriminellen im System des Strafvollzugs neu in den Blick nimmt. Wie die angeregten Debatten zeigten, gerät damit die Konstruktion der jeweiligen "Diskurse" in doppelter Hinsicht in den Blick: zum einen als Frage an den Forscher nach den Eigenheiten der einzelnen zeitgenössischen Diskurse über die Person des Kriminellen (wobei die Quellen aus der Expertenperspektive naturgemäß reichhaltiger fließen), zum anderen aber auch nach der Perspektive, welche die Auswahl von unterschiedlichen Quellengattungen für die historiographische Behandlung des Themas impliziert. Experten und "Betroffene", "Beobachter", Täter und Opfer erscheinen dabei gleichermaßen, aber in unterschiedlicher, machtdurchwirkter Weise als Akteure wechselnder "Sprachspiele" um den Kriminellen, zu deren Entwirrung der deutsch-französische Workshop einen wichtigen Beitrag geleistet hat.
Den ganzen Tagungsbericht lesen ...
vabanque - am Mittwoch, 24. März 2004, 01:47 - Rubrik: Kriminalitaetsgeschichte allgemein
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
bei dejure.org zu den Delikten
Weitere Abfrage zum Begriff "Bankraub" bei der HRR-Strafrechtsdatenbank
vabanque - am Dienstag, 23. März 2004, 13:57 - Rubrik: Buergerliches Recht
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
